Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Konflikten

EHRENAMTLICHE GRUPPEN ALS AUSHANDLUNGSORTE DES GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALTS
In unseren Gesprächen mit Bautzenerinnen und Bautzenern wird die Spaltung der Gesellschaft in politische Lager wiederholt als starke Belastung beschrieben: Nachbarschaften, Freundschaften und Familien zerbrechen an Meinungsverschiedenheiten (etwa über Zuwanderungspolitik oder Maßnahmen gegen die Covid19-Pandemie) und Gespräche über umstrittene Themen werden aus Angst vor persönlichen Nachteilen gemieden. Trotz dieser angespannten Lage sind in Bautzen ehrenamtliche Gruppen zu finden, die über die Lager hinweg Kulturen des Zusammenhalts und der gemeinsamen Lösungsfindung erhalten oder geschaffen haben.
Hier stellen wir dar, wie solche lagerübergreifenden Gruppen (Mikro-Öffentlichkeiten) gestaltet sind und welche Bedeutung sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Die folgenden Zitate (aus Interviews mit 17 Personen aus 13 solcher Gruppen in Bautzen) vermitteln einen Eindruck von der Vielfalt der Perspektiven. Ähnlichkeiten der Grafiken mit tatsächlichen Personen in Alter, Geschlecht, oder sonstiger äußerlicher Merkmale sind zufällig.

Wie wird die Polarisierung in Bautzen von Akteur:innen im Ehrenamt wahrgenommen?
Man kriegt das schon mit, dass es da verschiedene Meinungsbilder gibt.
Aber ich bin jetzt jemand, der sagt ‚Ok ich beschäftige mich mit Fußball und meiner
Arbeit‘.
Sportverein
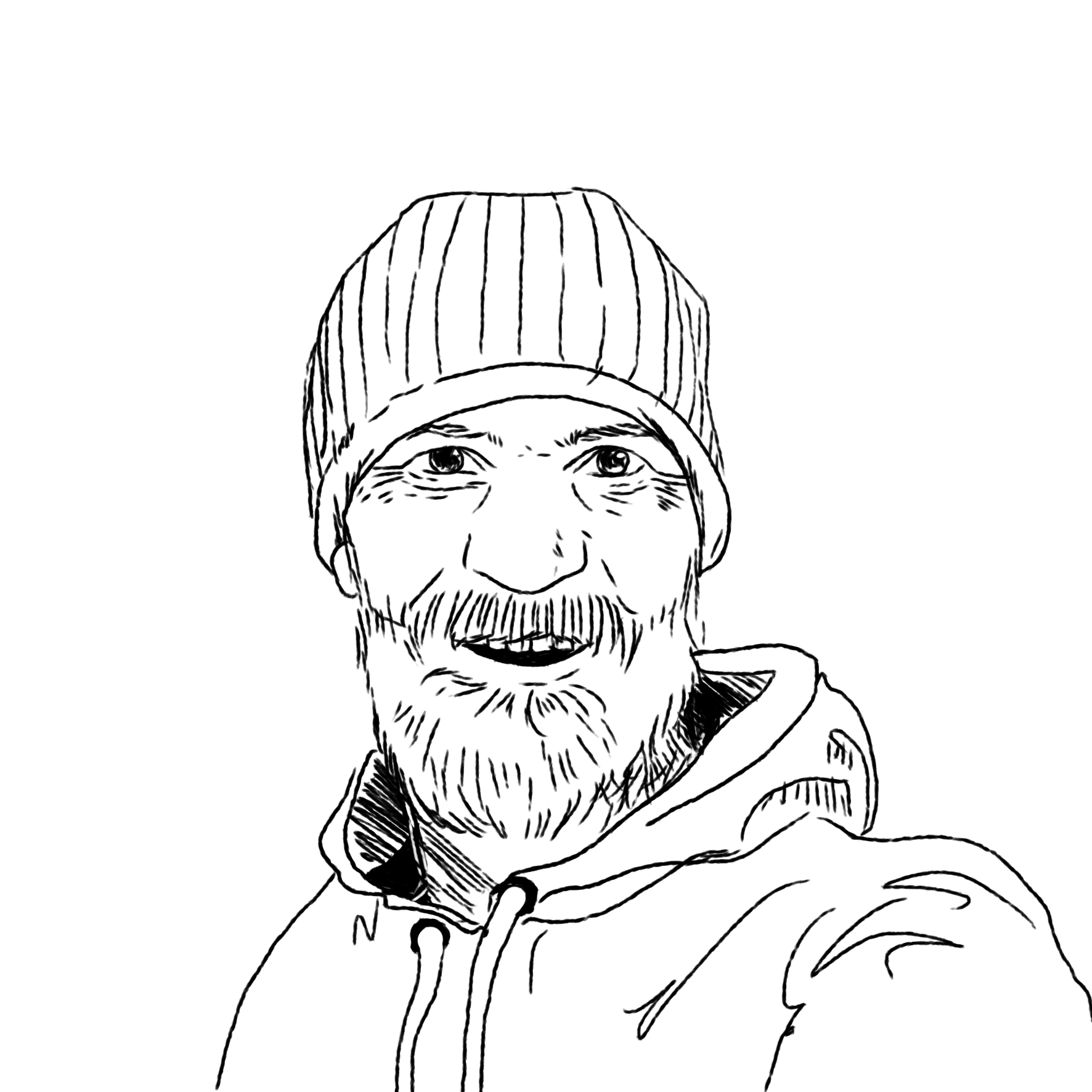
Es gibt hier 'ne Polarisierung nach rechts und links. Man hat hier keine bürgerliche Mitte mehr. Und wer sich hier nicht positioniert, der wird einfach von den anderen in irgendeine Ecke gedrückt, beziehungsweise man traut sich überhaupt nicht mehr, seine Meinung zu sagen.
Sportverein
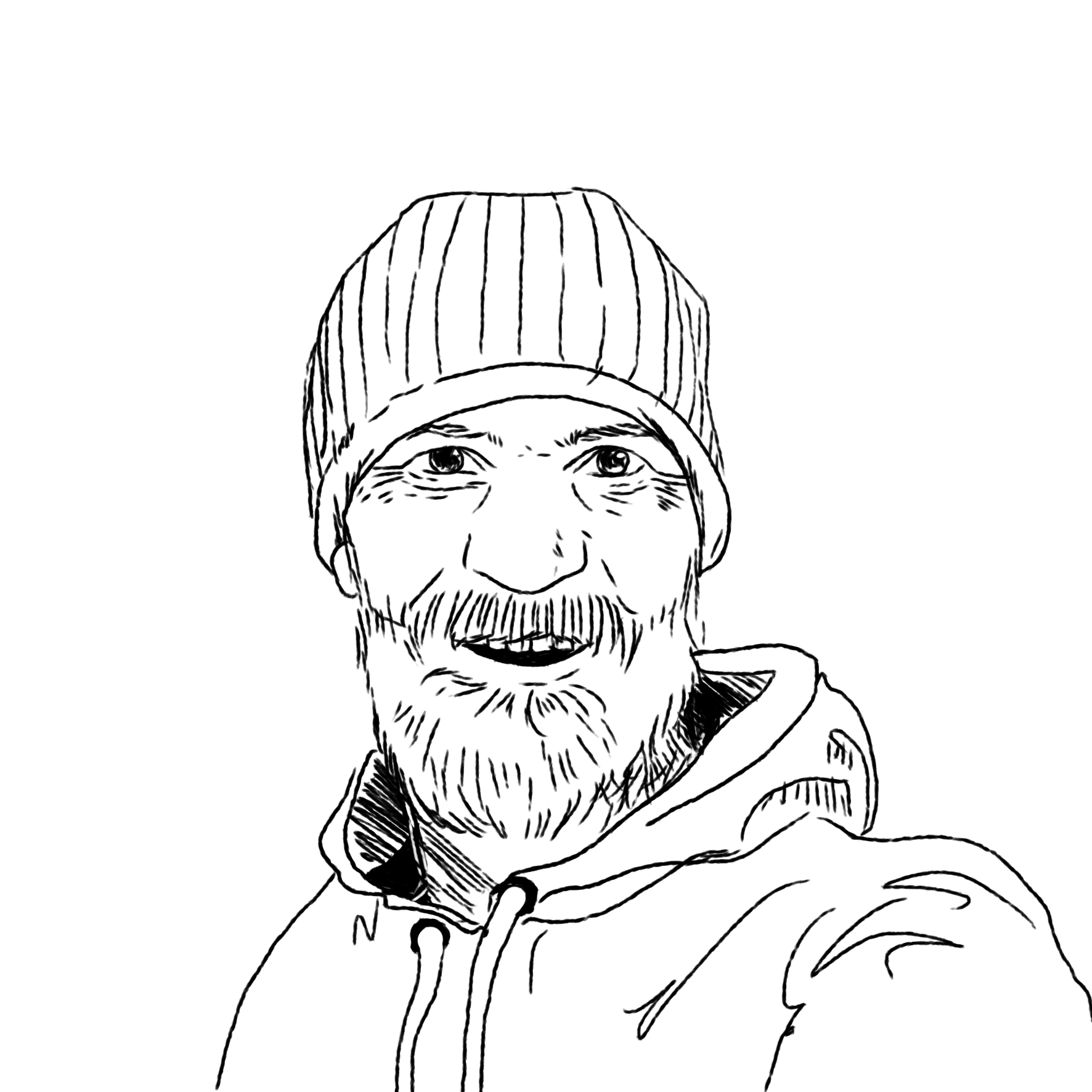
Ich glaube, die Polarisierung in Bautzen ist ein Abbild, was in Summe in der Gesellschaft passiert. Ich glaube, dass Bautzen überhaupt nicht irgendwo ein Sonderfall ist.
Bürgerschafts-
initiative
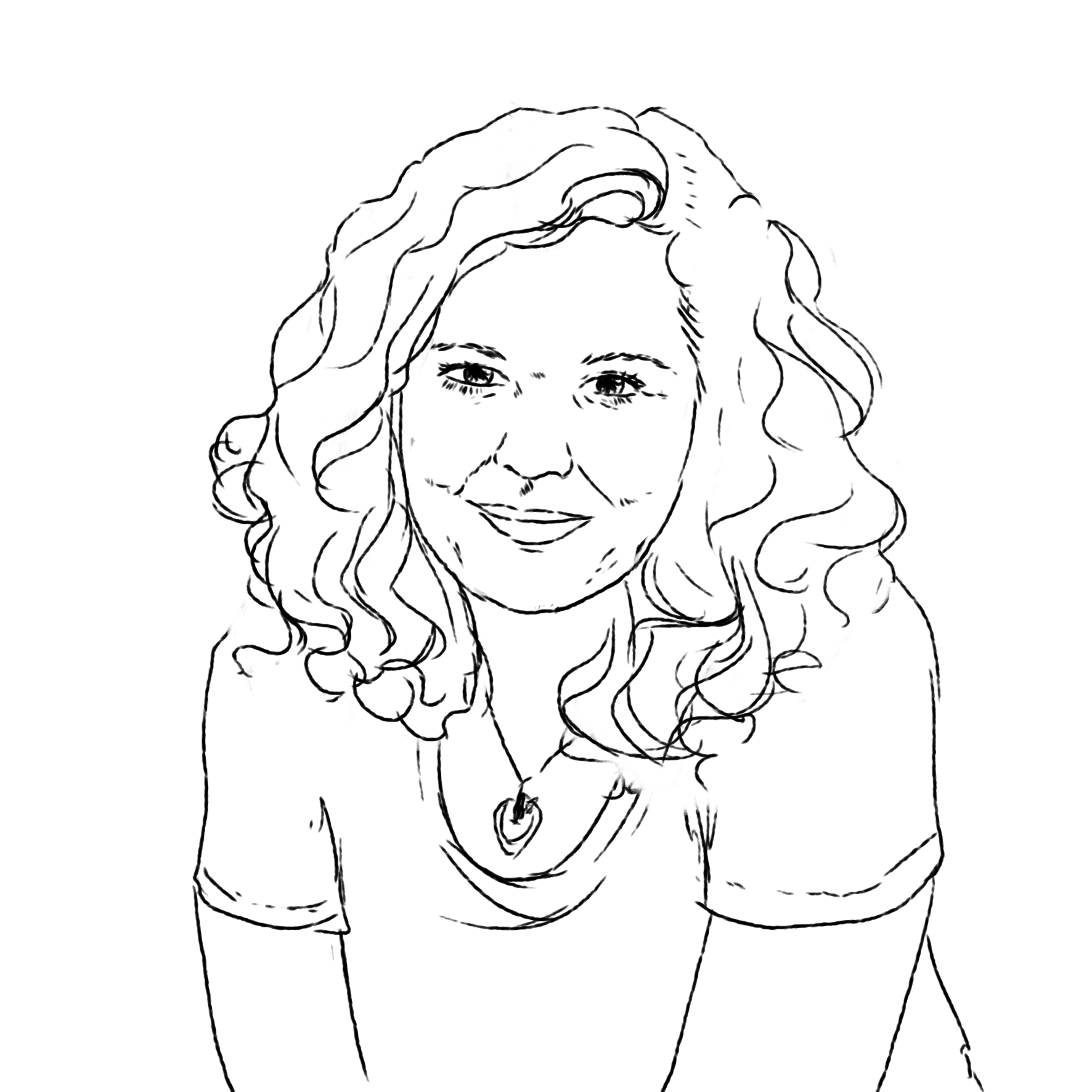
Ich war sehr unglücklich, dass die Leute in unserer Nachbarschaft sich nicht mehr unterhalten haben, es gab keinen Schwatz mehr auf der Straße, es war nur noch Missmut und ‚Scheiß Merkel. Und die ganzen Flüchtlinge. Wo kommt man da hin, wer soll denn das alles bezahlen?‘ Das Übliche – bis zu den Verschwörungstheorien.
Nachbarschafts-
initiative
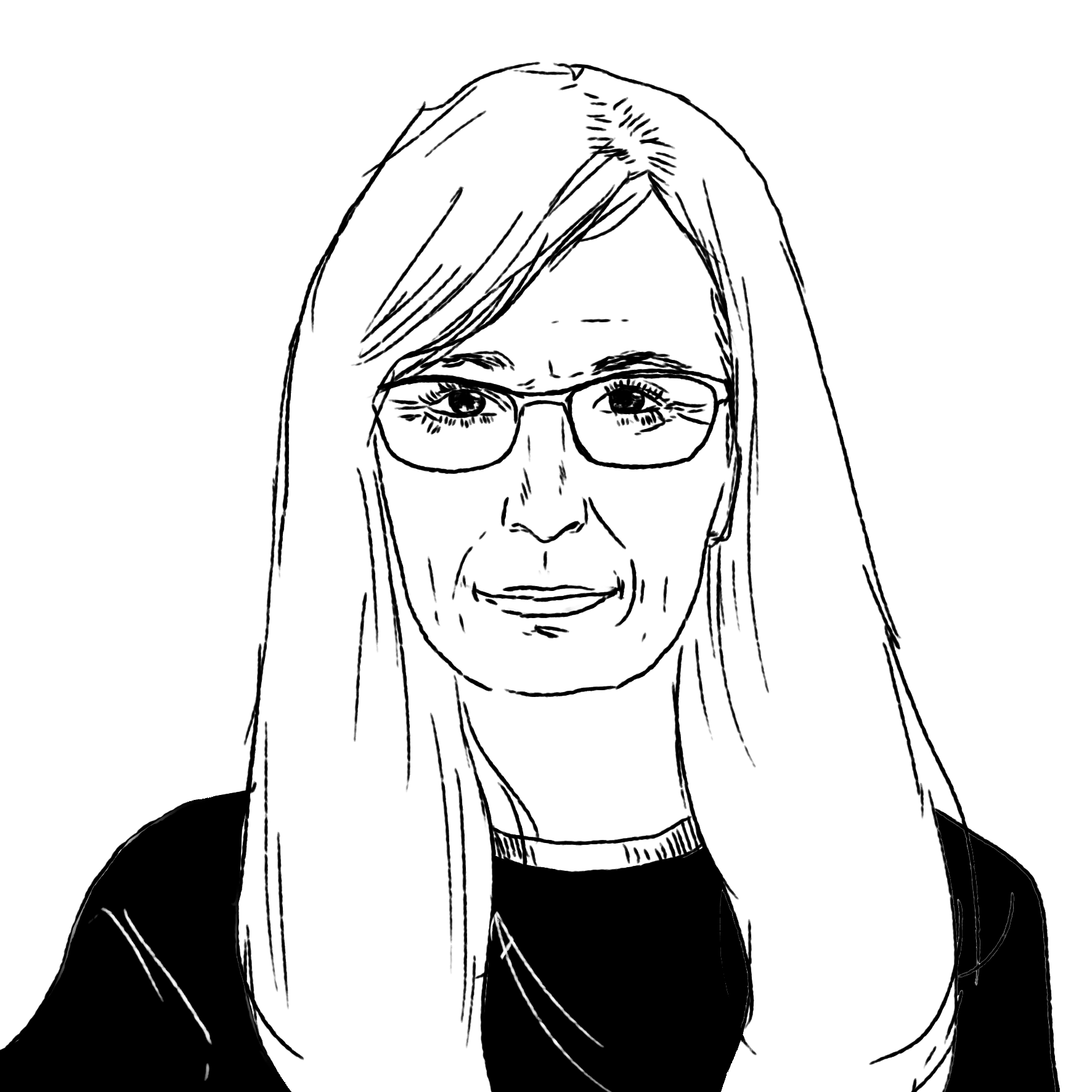
Ich bin auch Stadträtin in Bautzen und dort erlebt man sehr stark, dass diese Polarisierung vorhanden ist und dass da tatsächlich verschiedene Sachen nur aus dieser Perspektive entschieden werden.
Nachbarschafts-
initiative
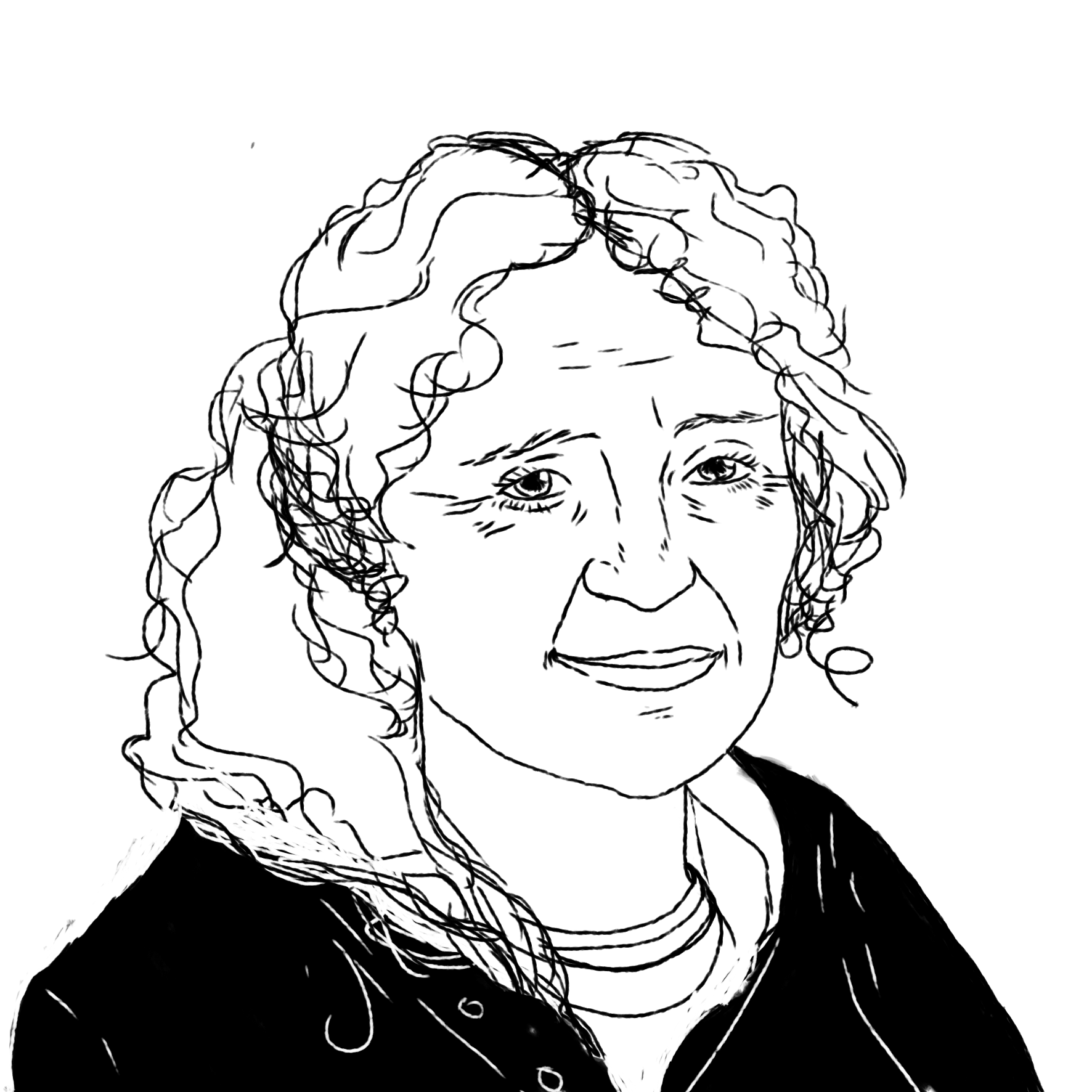
Ich glaube, die Polarisierung in Bautzen ist ein Abbild, was in Summe in der Gesellschaft passiert. Ich glaube, dass Bautzen überhaupt nicht irgendwo ein Sonderfall ist.
Bürgerschafts-
initiative
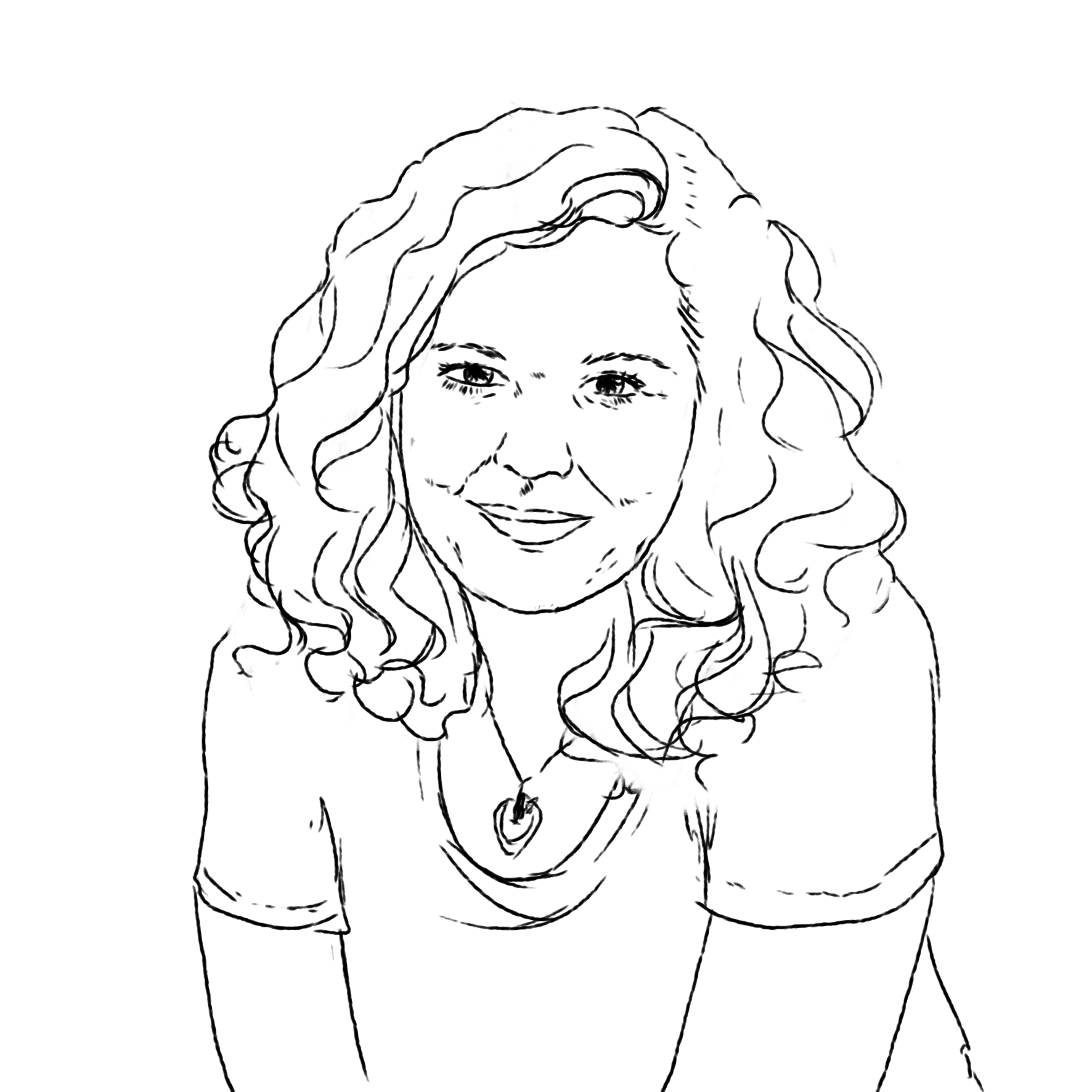
Ich bin auch Stadträtin in Bautzen und dort erlebt man sehr stark, dass diese Polarisierung vorhanden ist und dass da tatsächlich verschiedene Sachen nur aus dieser Perspektive entschieden werden.
Nachbarschafts-
initiative
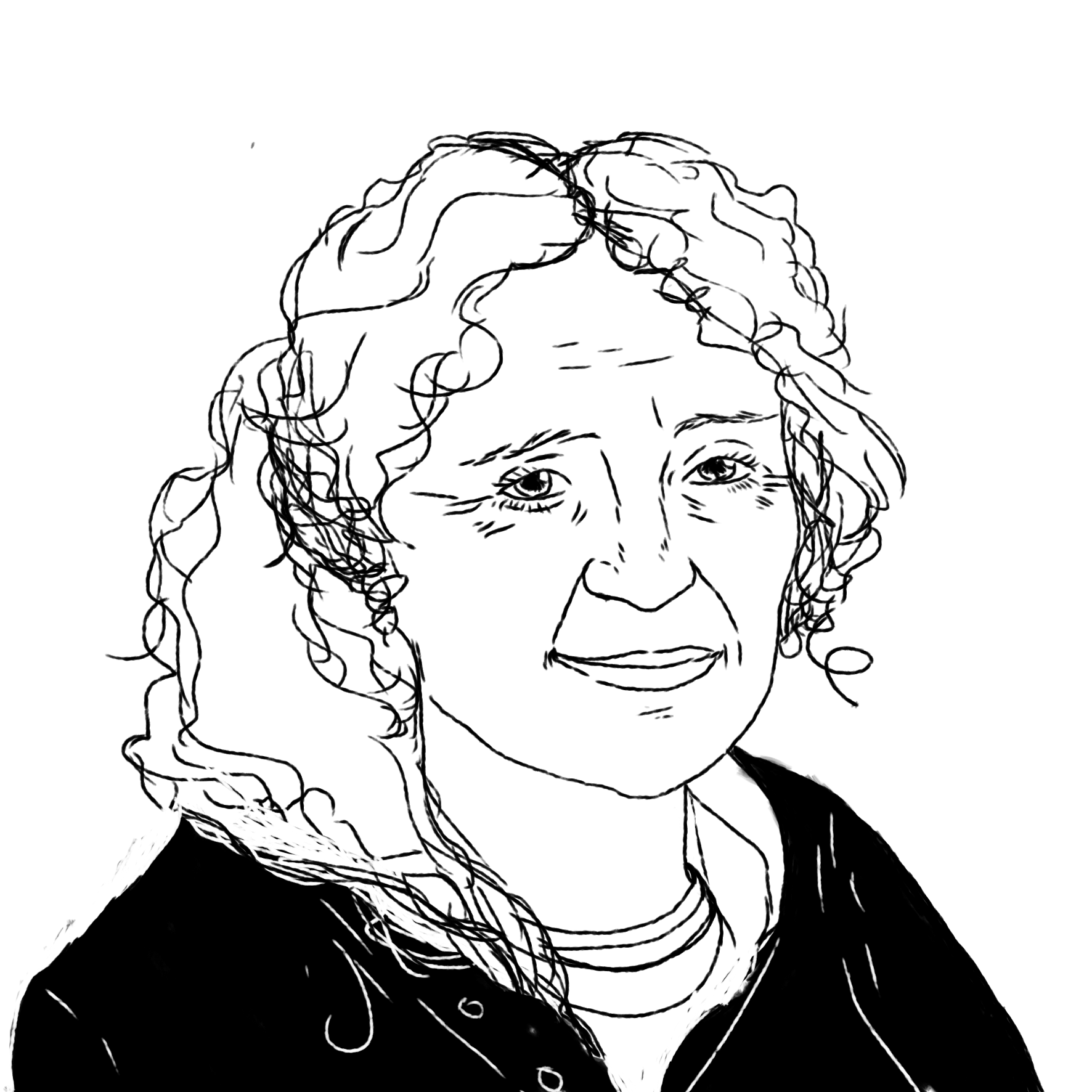
WAS FÜHRT DAZU, DASS EHRENAMTLICHE VEREINE UND INITIATIVEN PRODUKTIV ZUSAMMENARBEITEN UND MITEINANDER IM AUSTAUSCH BLEIBEN, OBWOHL IHRE MITGLIEDER VERSCHIEDENE POLITISCHE UND IDEOLOGISCHE POSITIONEN HABEN?
Diese Frage steht im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts. Auf Grundlage der Antworten haben wir 4 Thesen dazu aufgestellt.
Politisch breit aufgestellt
Wichtig ist die Kommunikation und wichtig ist, dass man miteinander redet. Es gibt auch bei uns eine ganze Menge unterschiedlicher Positionen von sehr AfD-nah bis ganz links. Wenn wir nicht mehr miteinander reden,
können wir aufhören.
Nachbarschafts-
initiative
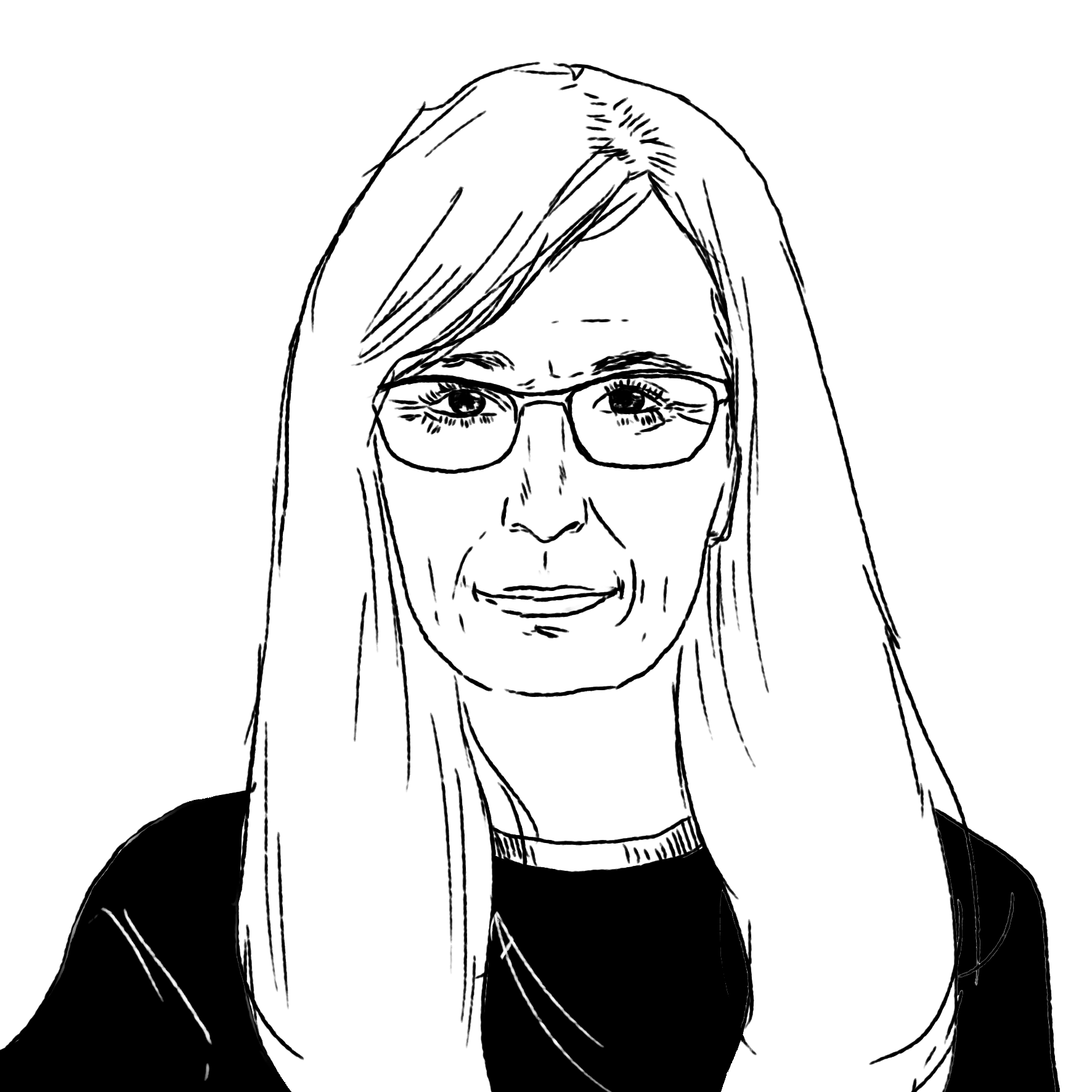
Betonung der eigenen Neutralität
Die unterschiedlichen Mitglieder sollen wirklich so ne Art neutrale Basis bilden. Also wir haben da niemanden ausgesperrt.
Nachbarschafts-
initiative
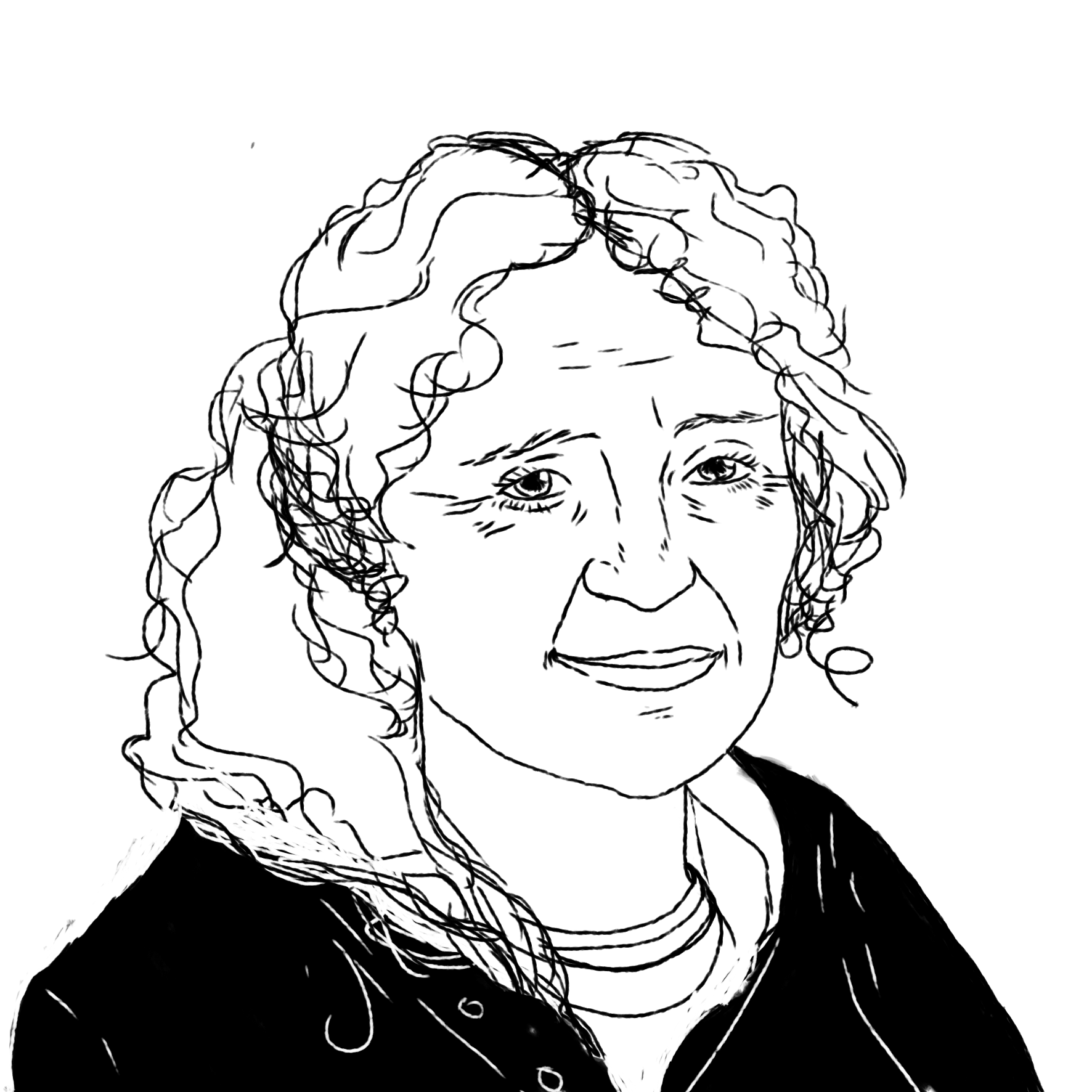
Sozial breit aufgestellt
Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Vom ehemaligen Knasti bis zum Doktor ist bei uns alles vertreten.
Sportverein
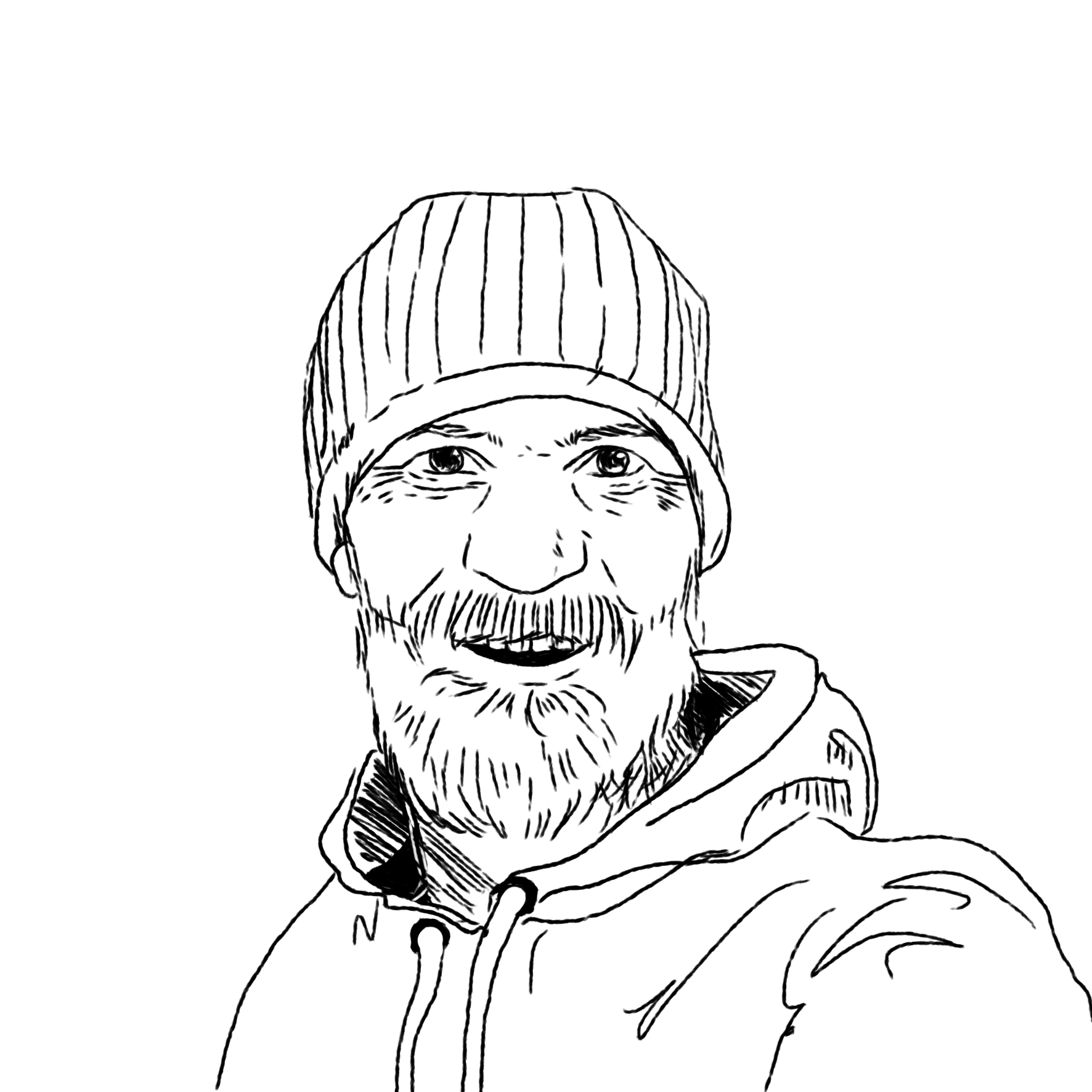
Konzentration auf gemeinsame Ziele und Tätigkeiten
Ich glaube, wenn man auf dem Fußballfeld steht, hat man andere Probleme, als irgendwelche Diskussionen über was in der Stadt gerade ist zu führen.
Sportverein
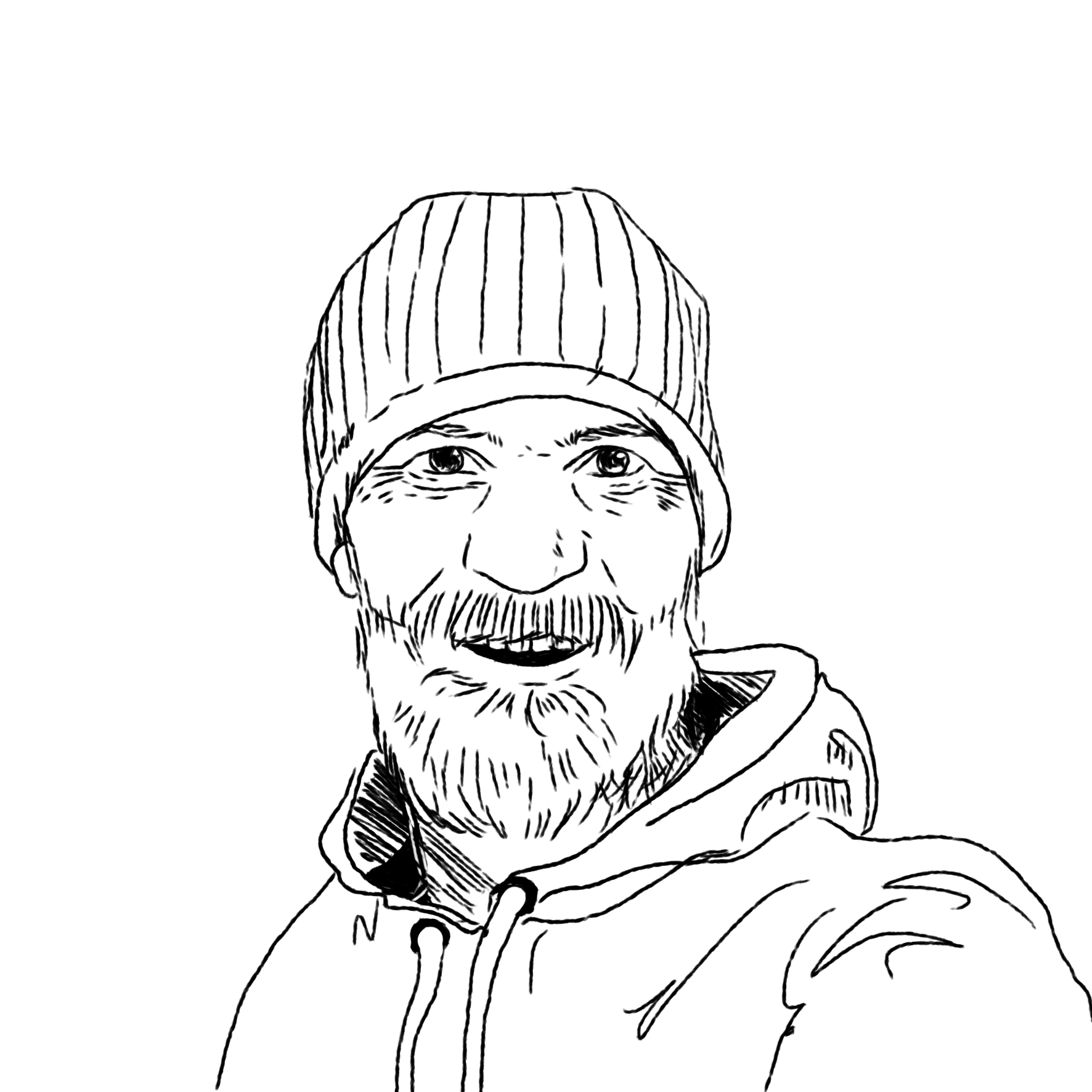
Betonung der eigenen Neutralität
Die unterschiedlichen Mitglieder sollen wirklich so ne Art neutrale Basis bilden. Also wir haben da niemanden ausgesperrt.
Nachbarschafts-
initiative
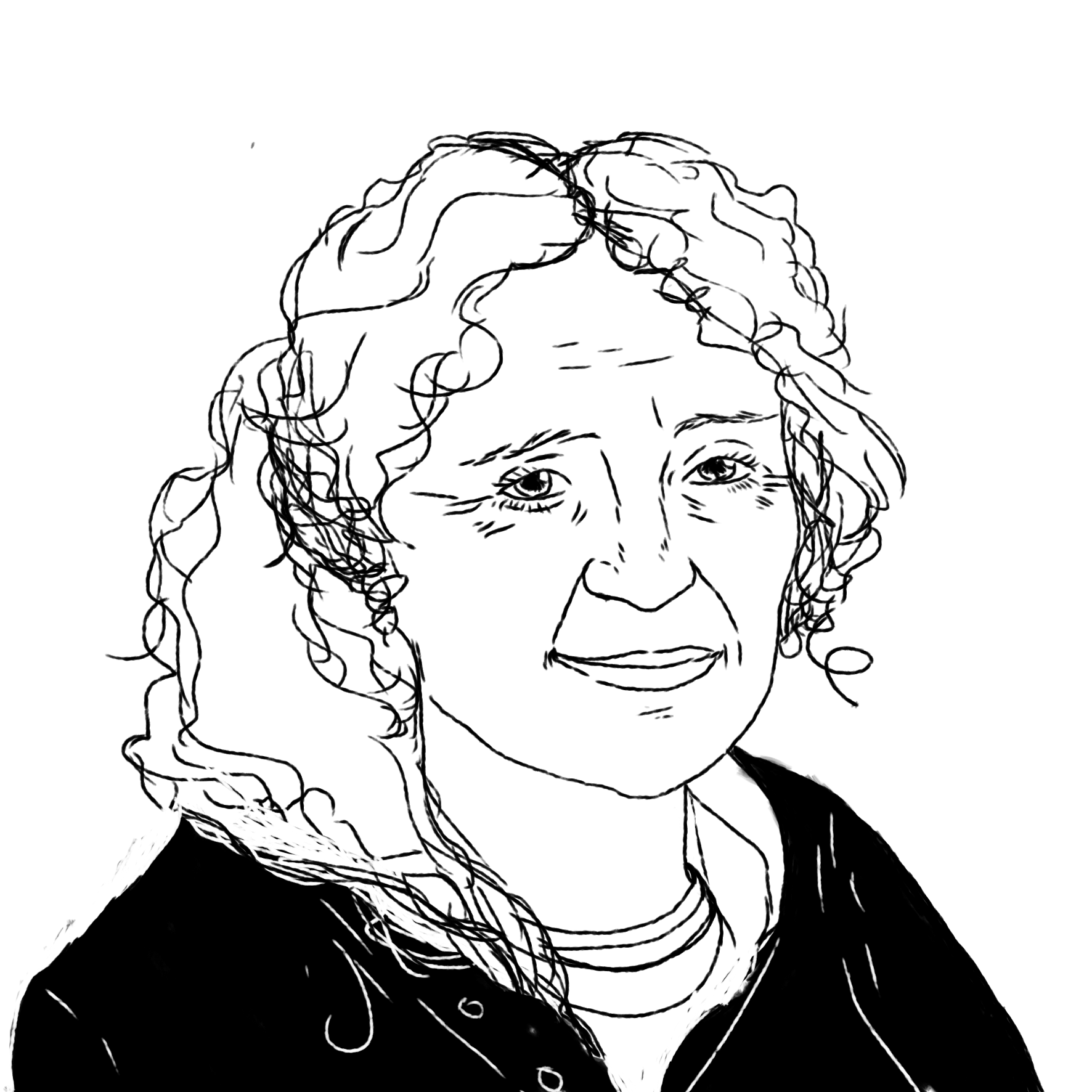
These 1:
MIKRO-ÖFFENTLICHKEITEN SIND SOZIALE GRUPPEN, DEREN MITGLIEDER VERSCHIEDENE, SOGAR GEGENSÄTZLICHE ANSICHTEN UND HINTERGRÜNDE HABEN.
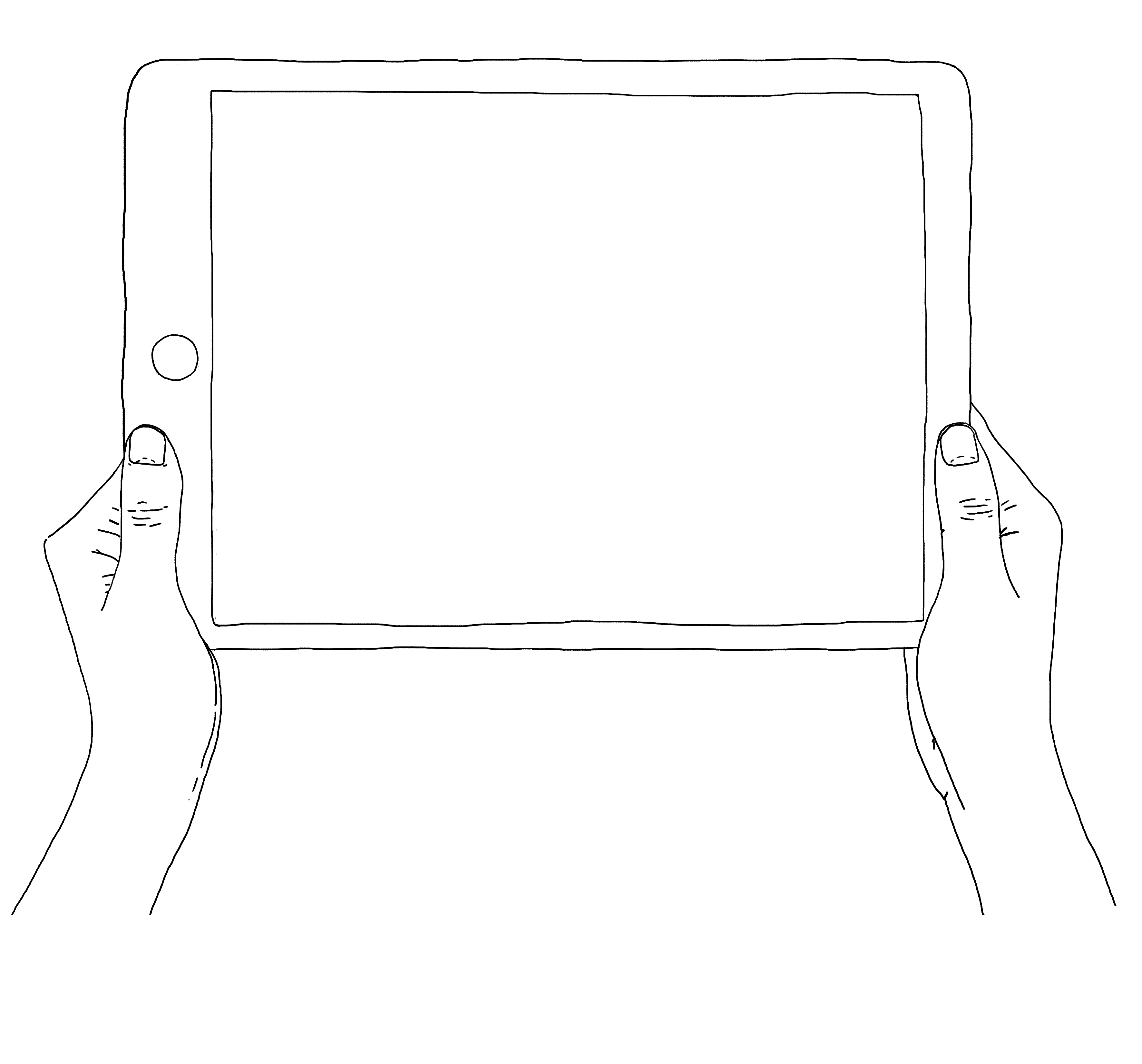
These 1
MIKRO-ÖFFENTLICHKEITEN SIND SOZIALE GRUPPEN, DEREN MITGLIEDER VERSCHIEDENE, SOGAR GEGENSÄTZLICHE ANSICHTEN UND HINTERGRÜNDE HABEN. WIR KONNTEN ZWEI BEGRÜNDUNGEN FINDEN, DURCH DIE SIE IHR SELBSTVERSTÄNDNIS ALS „LAGERÜBERGREIFENDE“ GRUPPE LEGITIMIEREN:
MOTIVIERENDE KERNGRUPPE
Um so ein Projekt wirklich zu inszenieren, braucht man ja auch ein paar wirklich aktive und mit Power ausgestattete Menschen. Wer ist denn bereit, ehrenamtlich sich zu treffen und zu sagen: 'Wir machen das einfach'?
Sozialer Verein
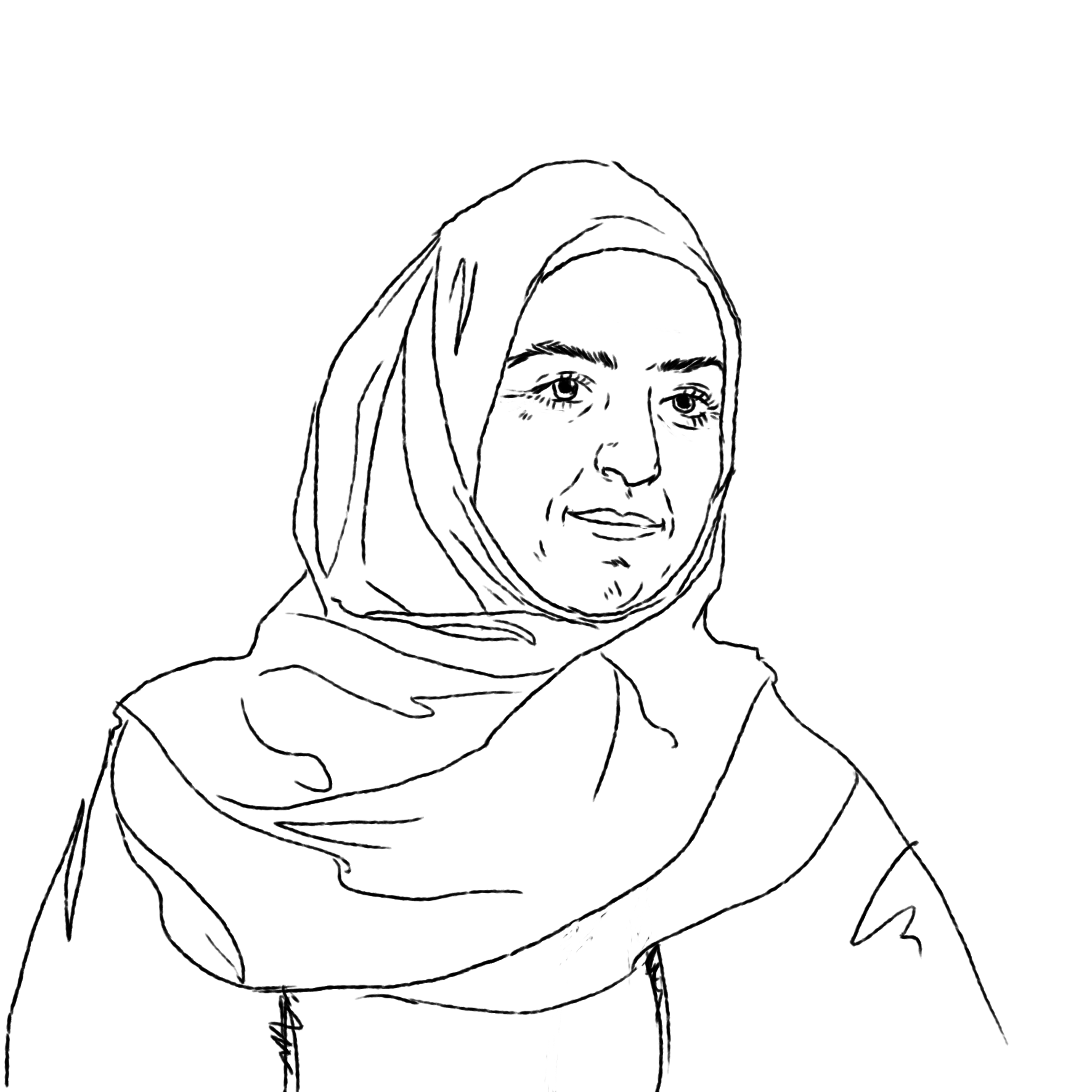
REGELMÄSSIGE TREFFEN
Ich versuche das zusammenzuhalten, in dem ich gucke, dass die regelmäßigen Treffen stattfinden.
Nachbarschafts-
initiative
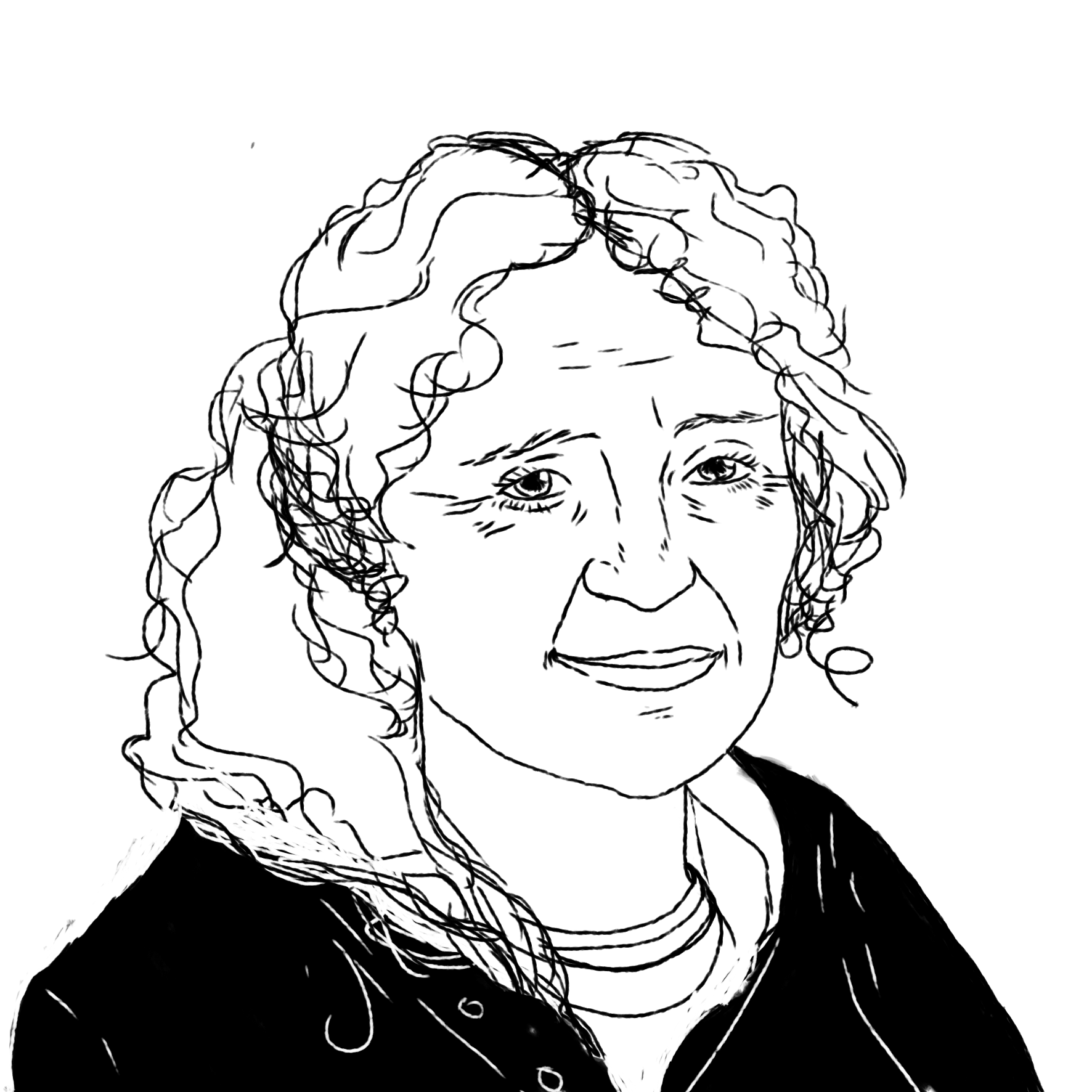
PERSÖNLICHER NUTZEN
Die Menschen kommen zu unseren Treffen, weil sie Vertrauen haben zum einen, weil die hier eine gewisse Aufrichtigkeit finden, und zum anderen, weil die Projekte ihnen ganz praktisch nützen.
RELIGIONS-
GEMEINSCHAFT
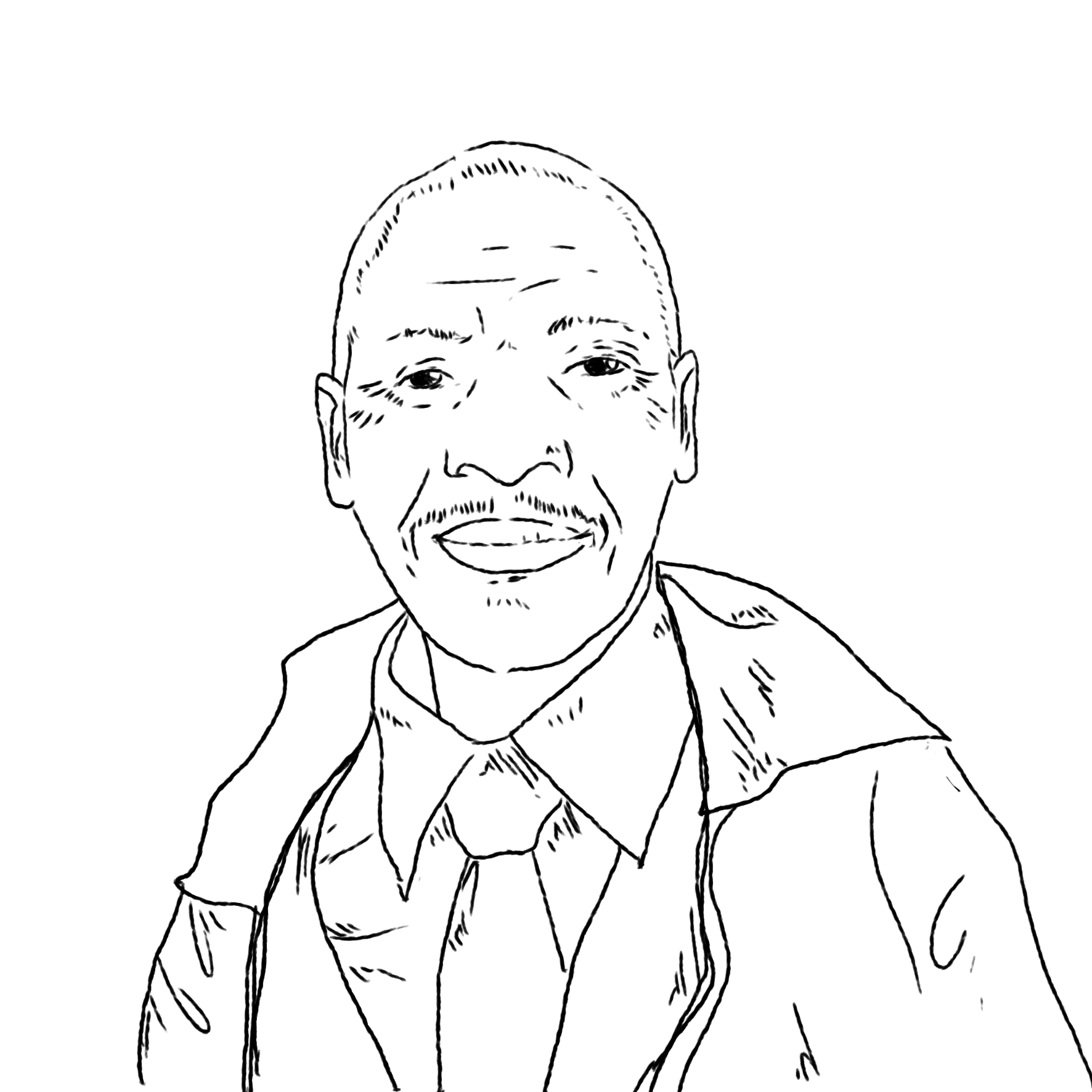
Gemeinsame Ziele
Wir haben uns in dieser Gemeinschaft dann gesagt ,Wie kann man das machen, wie schweißt man sich zusammen?` Wir schweißen uns zusammen über Projekte. Also erstens Umfeld verbessern und das zweite große Projekt ist eine öffentliche politische Gesprächsrunde. Dazu haben wir jetzt ein drittes Projekt, das ist das Weihnachtssingen.
Nachbarschafts-
initiative
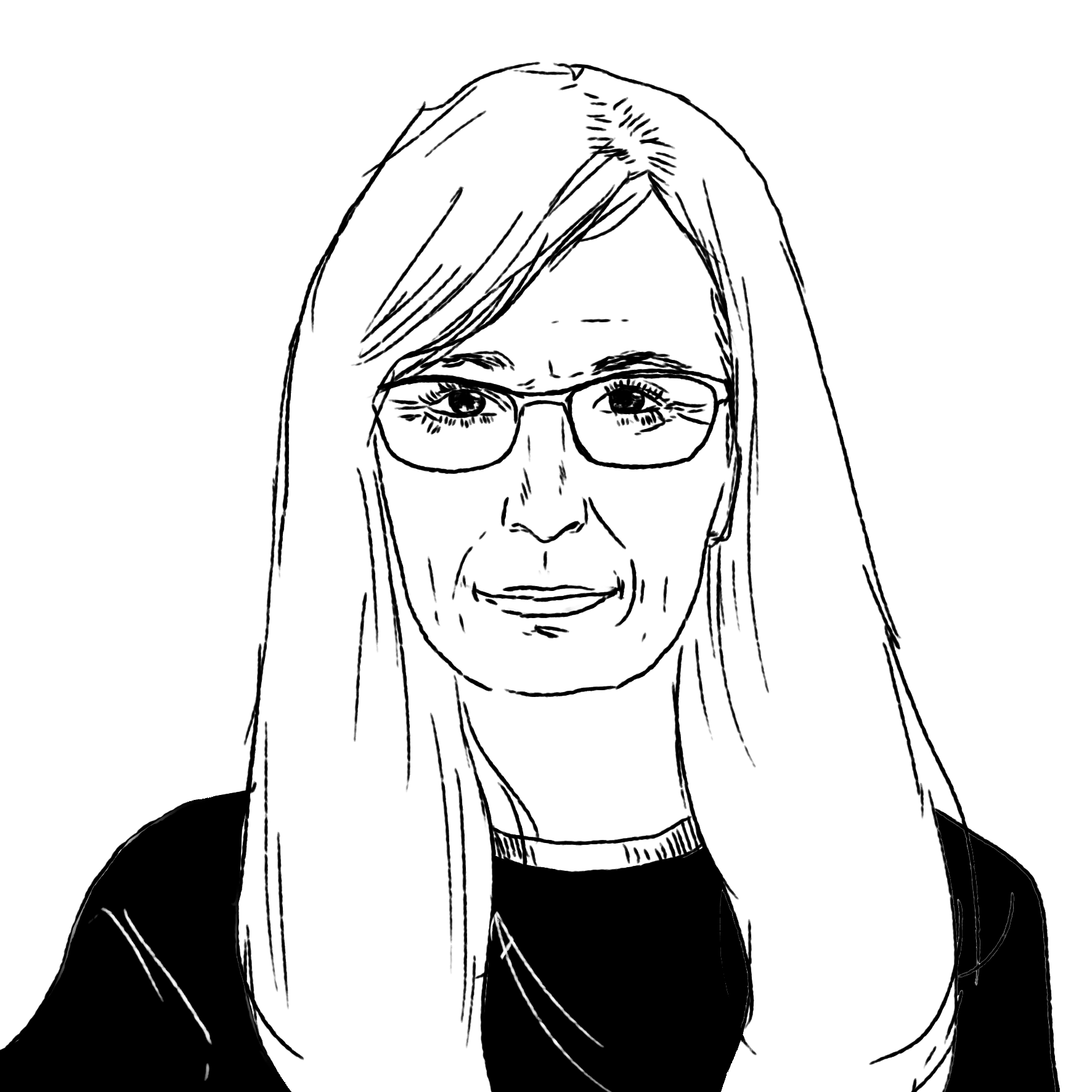
Persönlicher Nutzen
Die Menschen kommen zu unseren Treffen, weil sie Vertrauen haben zum einen, weil die hier eine gewisse Aufrichtigkeit finden, und zum anderen, weil die Projekte ihnen ganz praktisch nützen.
RELIGIONS-
GEMEINSCHAFT
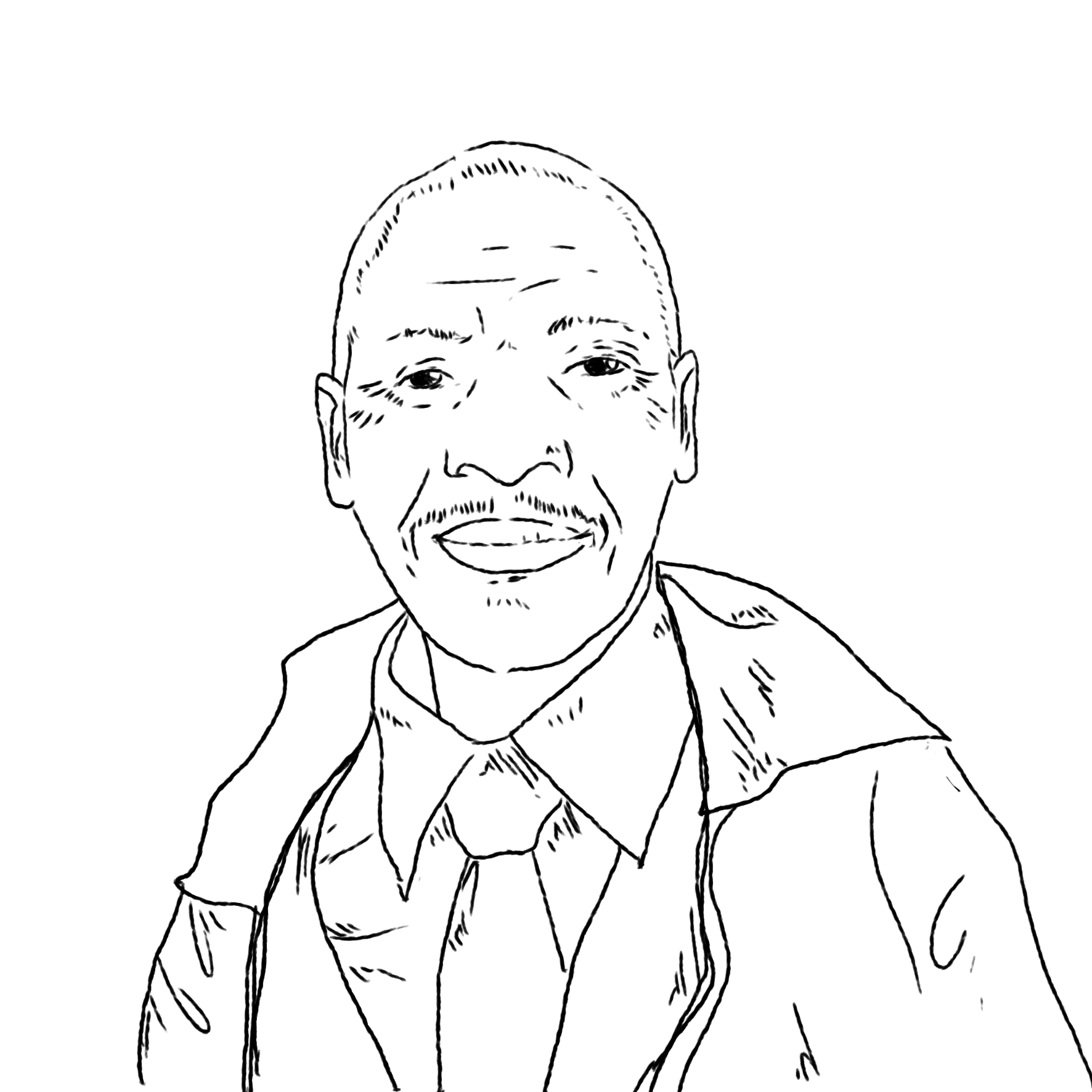
Persönlicher Nutzen
Die Menschen kommen zu unseren Treffen, weil sie Vertrauen haben zum einen, weil die hier eine gewisse Aufrichtigkeit finden, und zum anderen, weil die Projekte ihnen ganz praktisch nützen.
RELIGIONS-
GEMEINSCHAFT
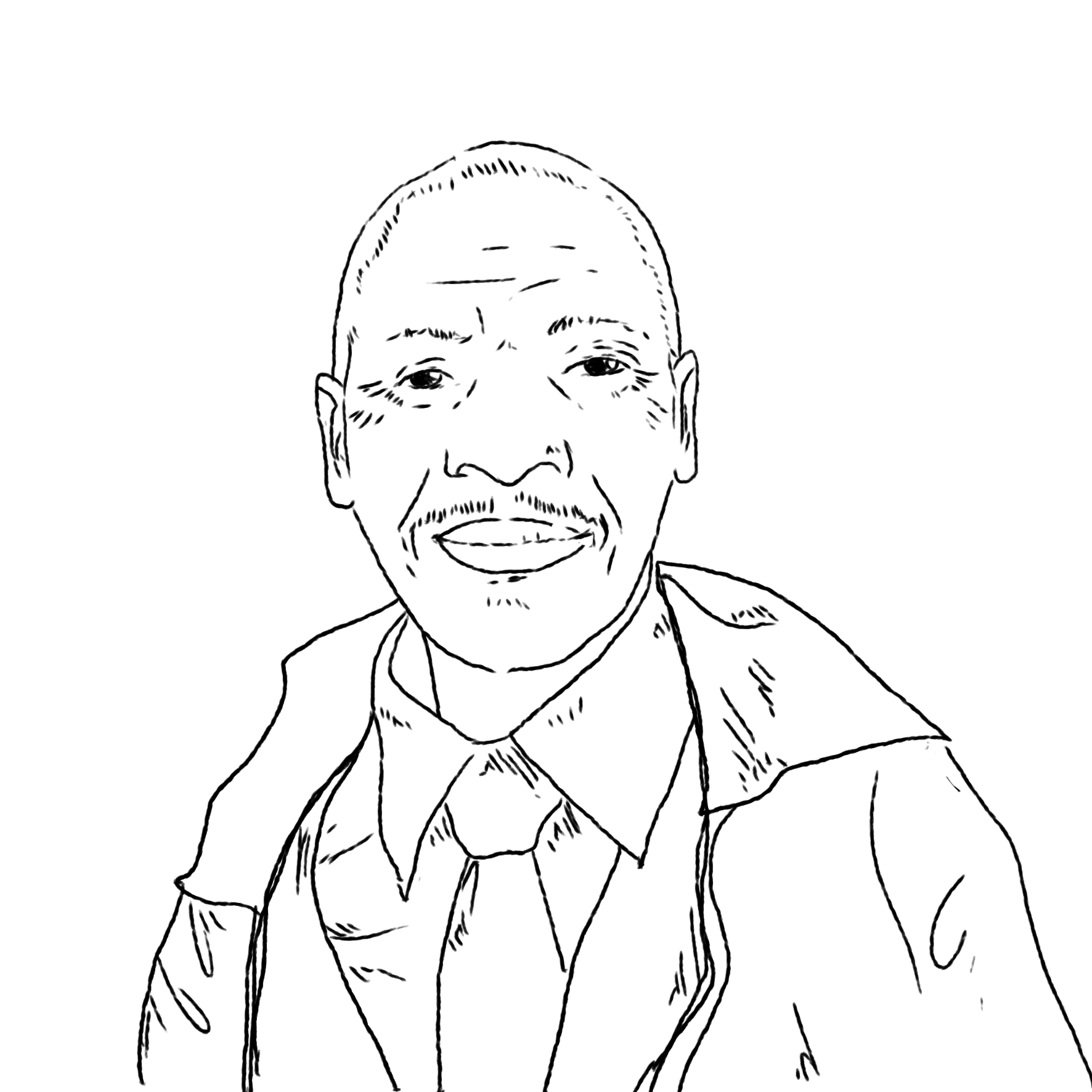
These 2:
MIKRO-ÖFFENTLICHKEITEN BILDEN „INTERESSENSGEMEINSCHAFTEN“, IN DENEN DAS ZUSAMMENHALTENDE GEGENÜBER DEM SPALTENDEN DER POLITISCHEN LAGERBILDUNG ÜBERWIEGT.
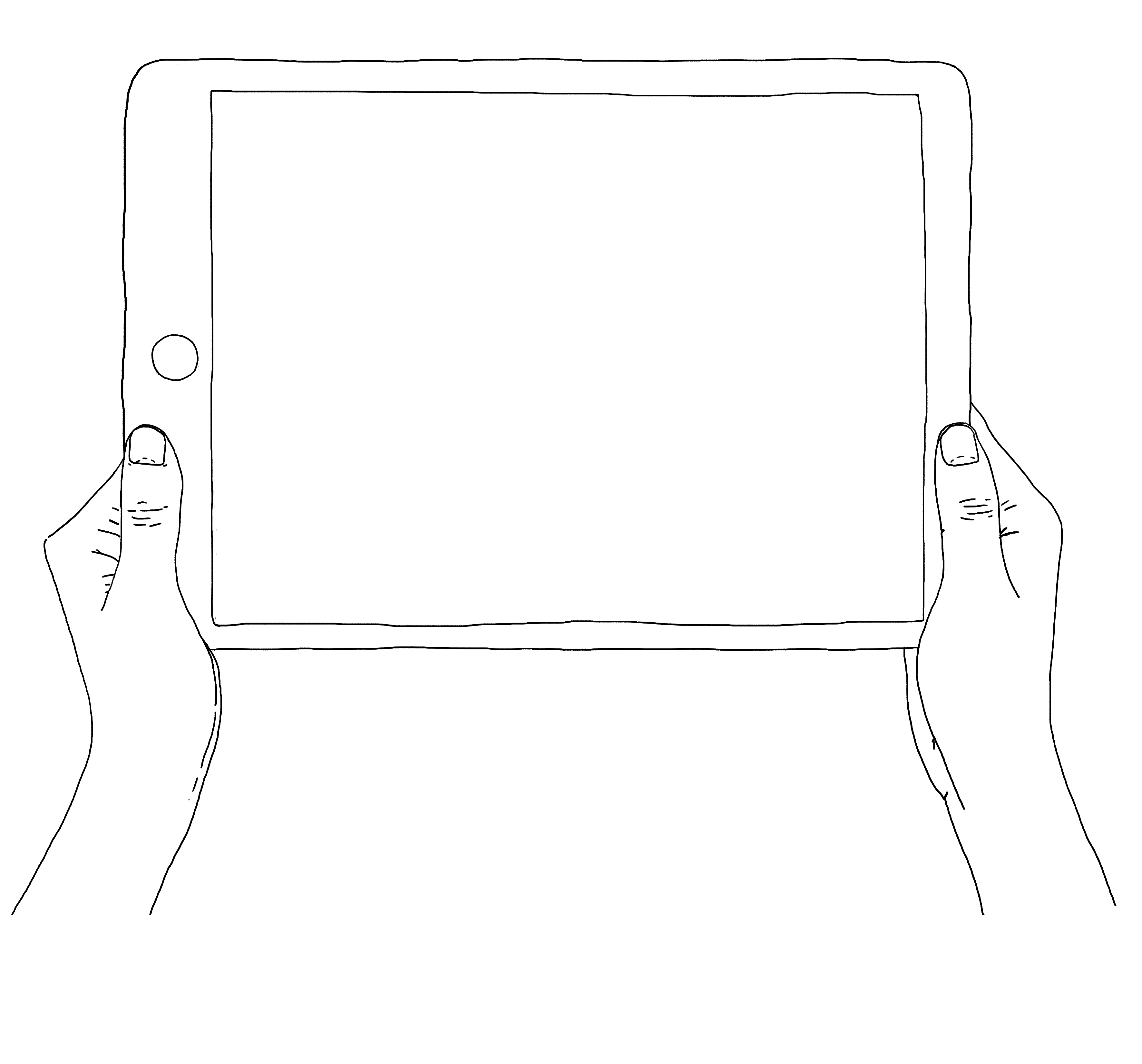
These 2
MIKRO-ÖFFENTLICHKEITEN BILDEN „INTERESSENSGEMEINSCHAFTEN“, IN DENEN DAS ZUSAMMENHALTENDE GEGENÜBER DEM SPALTENDEN DER POLITISCHEN LAGERBILDUNG ÜBERWIEGT. FAKTOREN, DIE DAZU BEITRAGEN SIND:
- Gemeinsame Ziele entwickeln Bindungskräfte zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern, die politische und soziale Differenzen überwinden können
- Ziele mit persönlichem Nutzen z.B. mit Bezug zum eigenen Lebensumfeld, oder dem Gefühl der Selbstwirksamkeit wirken motivierend
- Regelmäßige Treffen halten die Gruppe zusammen und das Gespräch am Laufen
- „Motivatoren“ aktivieren die Gruppenmitglieder zur beständigen Zusammenarbeit
FESTGESCHRIEBENE REGELN
Ich hab dann irgendwann die Satzung ganz groß gedruckt und die auch ausgehängt. Die Satzung war dann mein innerlicher Rettungsanker. ‚Was machst du hier und wozu bist du
hier verpflichtet?‘.
Sozialer
Verein
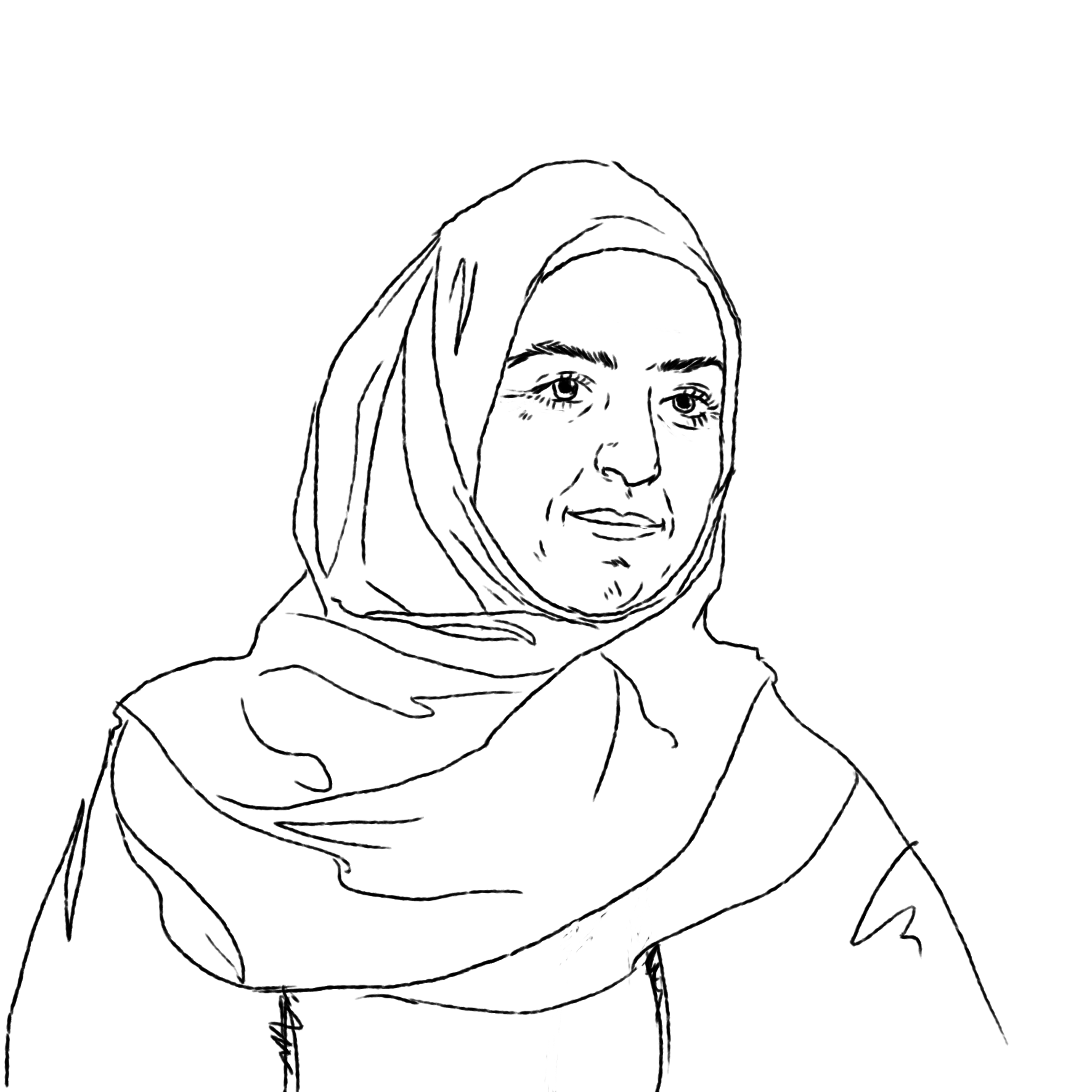
NACHVOLLZIEHBARE ENTSCHEIDUNGEN
Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber dann wär‘s wichtig, dass man auch darüber spricht, wie das alles gehandhabt wird, welche Entscheidungsprozesse oder wie die Entscheidungsprozesse ablaufen.
Sozialer
Verein
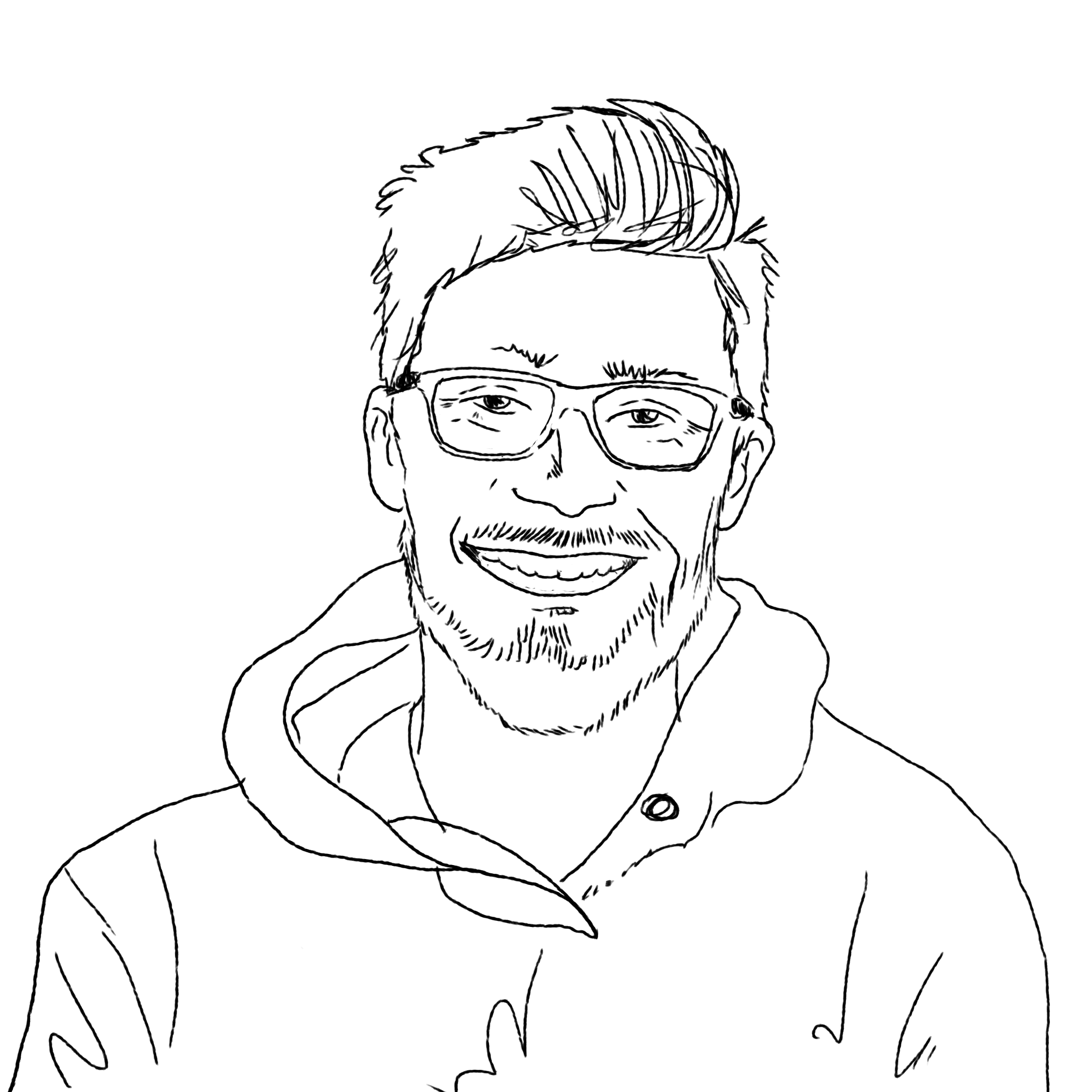
SELBST ERARBEITETE UMGANGSREGELNN
Bei uns gibt es 'ne Gruppe, die haben auch Regeln aufgestellt, ja, wie sie sich unterhalten in ihrer Gruppe: ‚So wollen wir uns unterhalten‘. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man loswird, was man so emotional aufgenommen hat.
Religiöse
Initiative
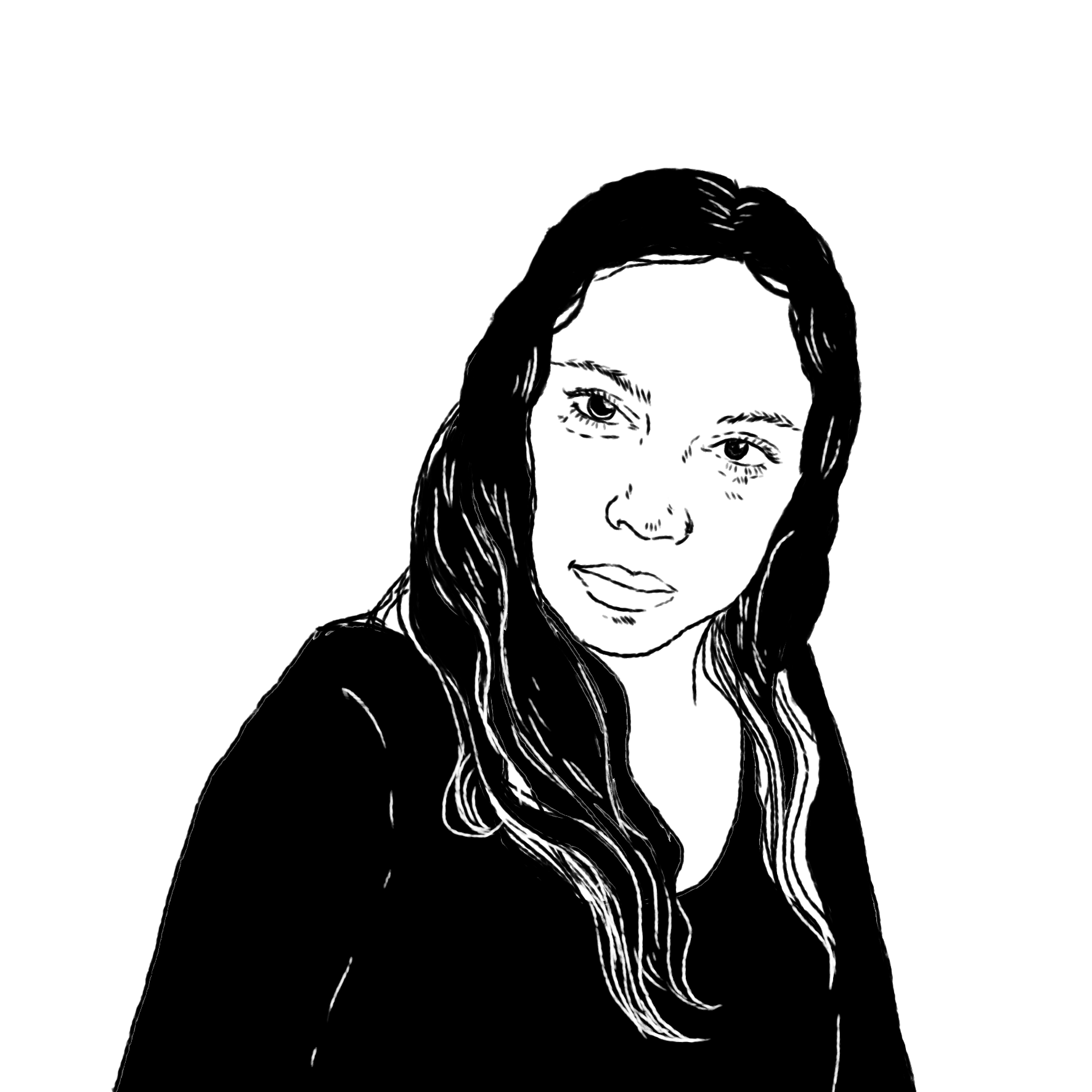
NICHT-FESTGESCHRIEBENE REGELN
Es gibt nicht-festgehaltene Regeln, die jeder weiß, und es halten sich auch alle dran.
Nachbarschafts-
initiative
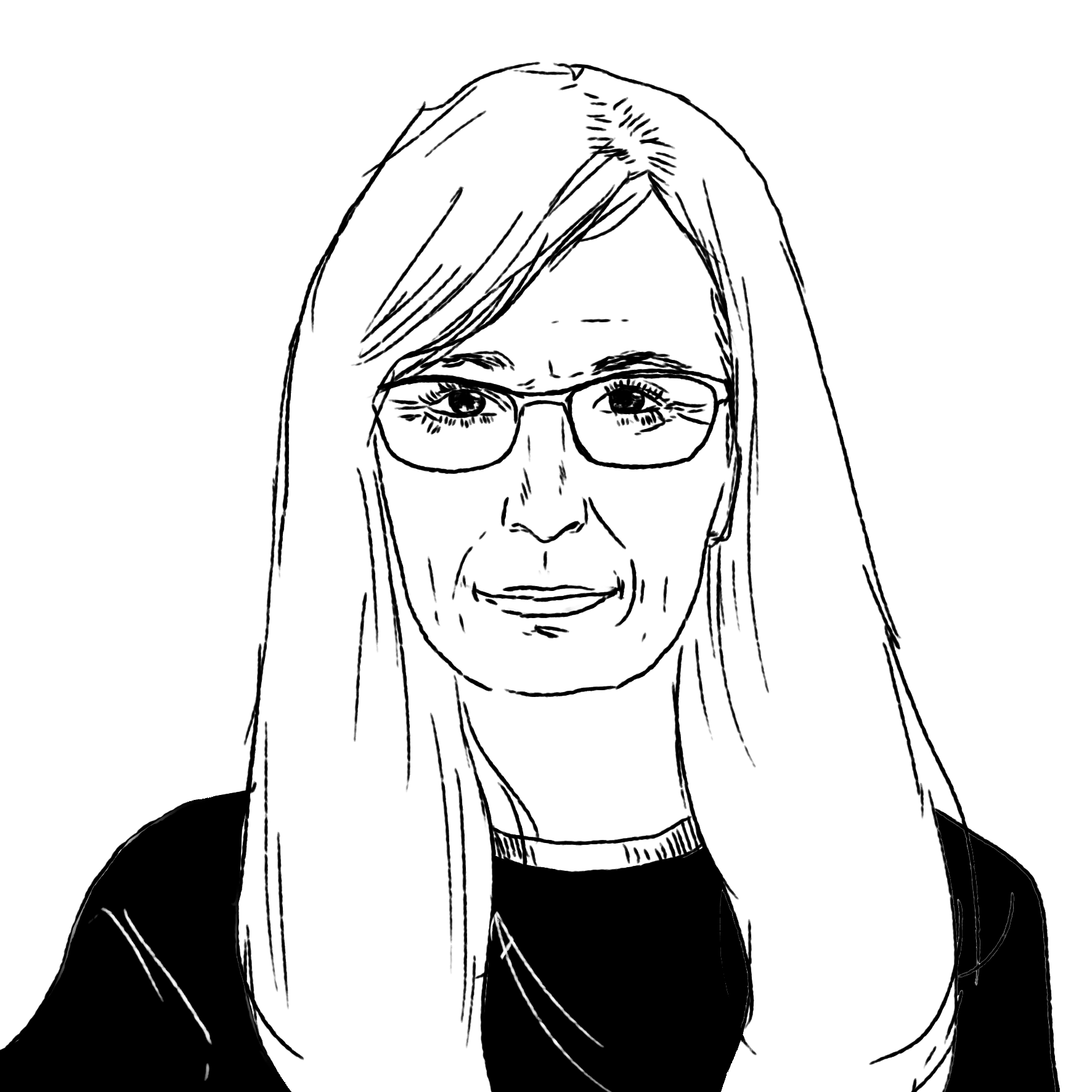
ENTSCHEIDUNGEN GEMEINSAM TREFFEN
Bei unseren ersten Treffen ging es überwiegend um organisatorische Fragen. Und die wurden richtig besprochen. Wir wollen ja nicht als Chef auftreten, sondern das soll ja wirklich ein demokratischer Prozess sein.
Ehrenamts-
Netzwerk
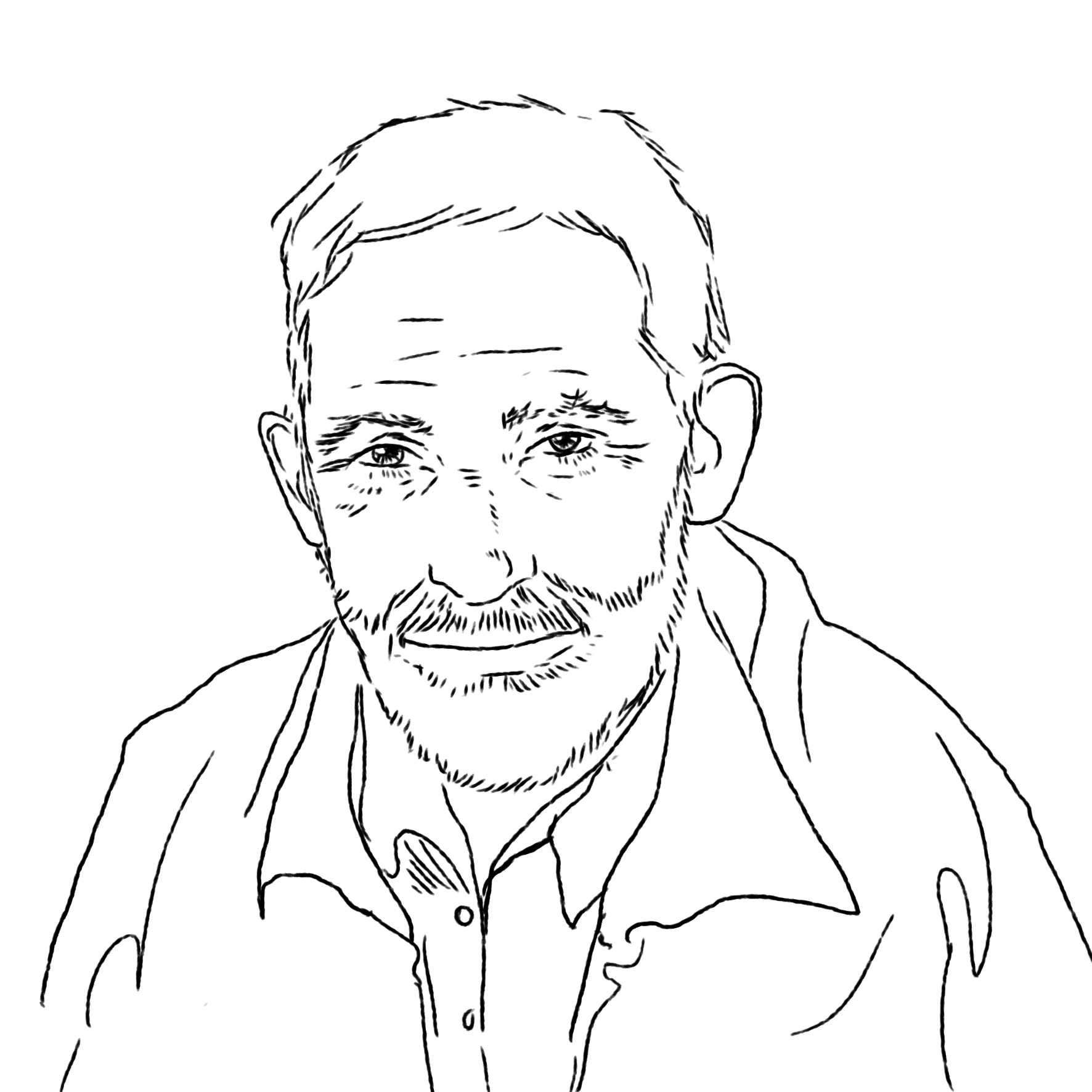
SELBST ERARBEITETE UMGANGSREGELNN
Bei uns gibt es 'ne Gruppe, die haben auch Regeln aufgestellt, ja, wie sie sich unterhalten in ihrer Gruppe: ‚So wollen wir uns unterhalten‘. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man loswird, was man so emotional aufgenommen hat.
Religiöse
Initiative
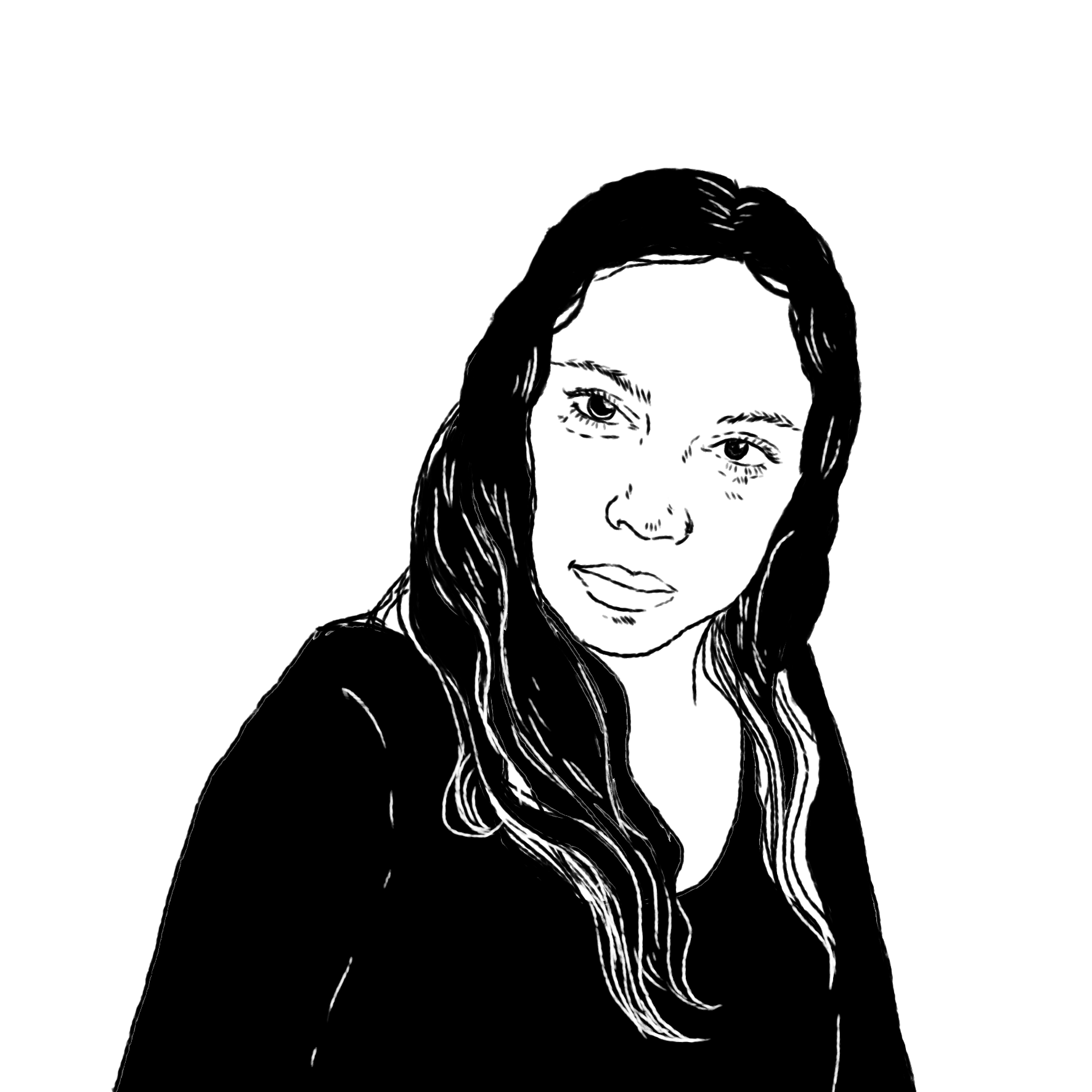
These 3:
KLARE REGELN ERMÖGLICHEN DIE ZUSAMMENARBEIT VON PERSONEN MIT VERSCHIEDENEN POLITISCHEN UND IDEOLOGISCHEN HINTERGRÜNDEN, INDEM SIE EINEN RAHMEN FÜR DEN GEGENSEITIGEN UMGANG MITEINANDER SETZEN.
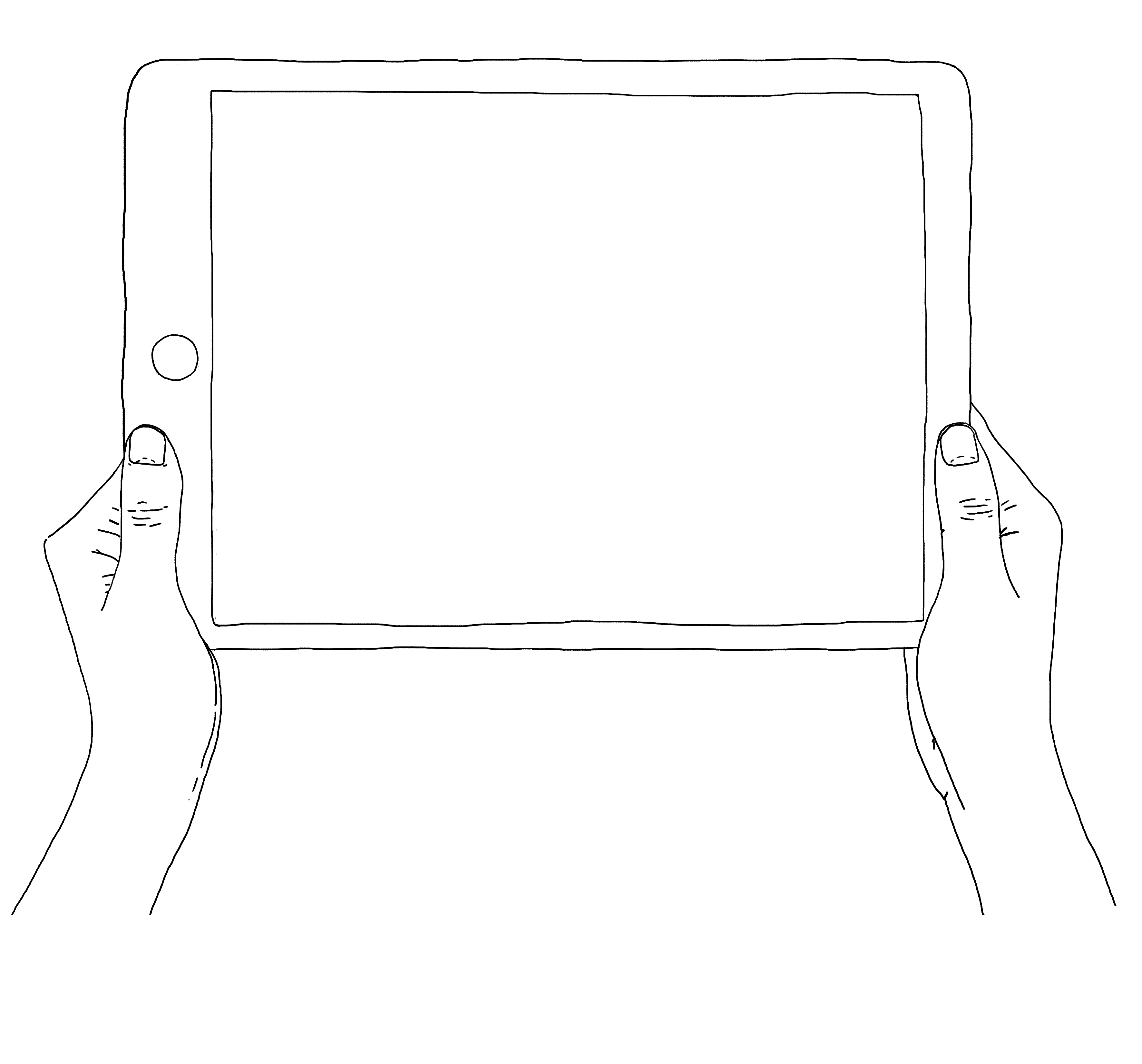
These 3
KLARE REGELN ERMÖGLICHEN DIE ZUSAMMENARBEIT VON PERSONEN MIT VERSCHIEDENEN POLITISCHEN UND IDEOLOGISCHEN HINTERGRÜNDEN, INDEM SIE EINEN RAHMEN FÜR DEN GEGENSEITIGEN UMGANG MITEINANDER SETZEN.
Ebene der
Zusammenarbeit
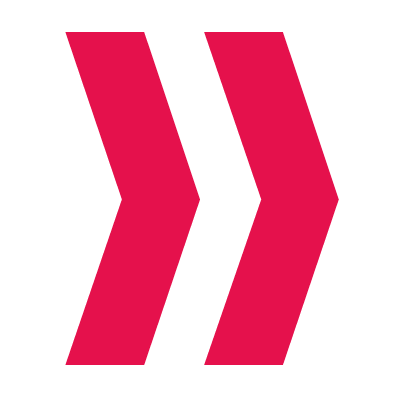
Die Aushandlung in unserer Gruppe ist anstrengend, weil es eben auch an die Substanz geht, wer sich so öffentlich auch sehr offen positioniert, und das auch trotz unserer verschiedenen
Ansichten.
Sozialer
Verein
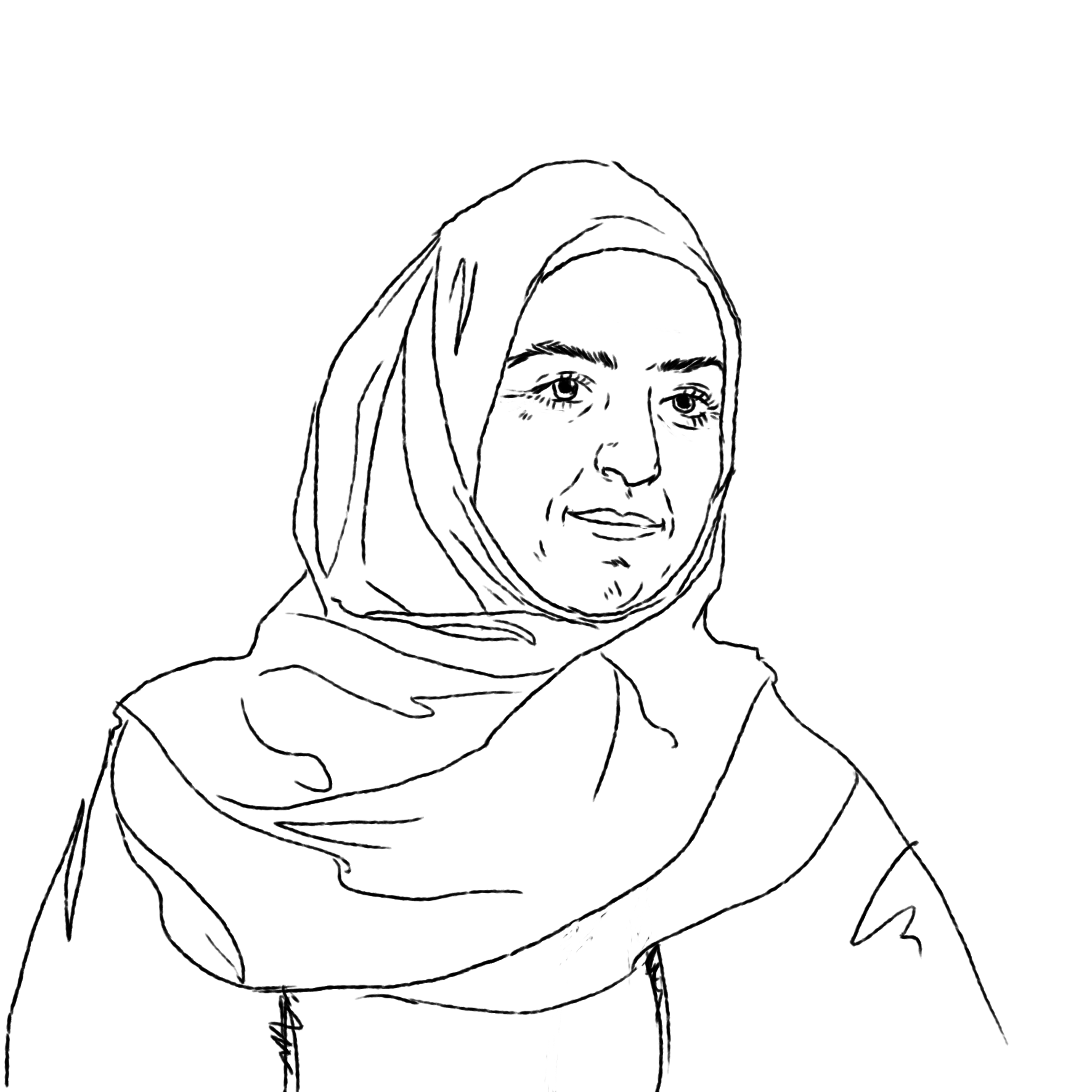
Ebene der Reflexion und emotionalen Auslastung
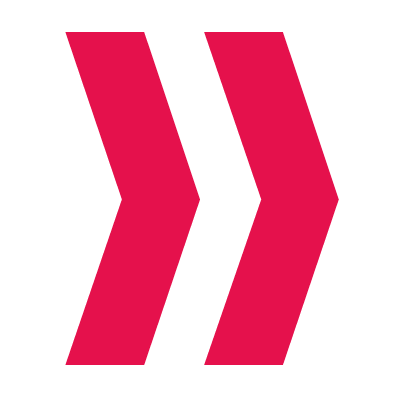
Also, wenn‘s kritisch wird, gehen meistens die Raucherinnen wieder runter und dann war das Problem eigentlich weg. Ich glaube, das ist auch schon so diese Streitfähigkeit, dass man sagt: ,Ich stehe jetzt zu meiner Meinung, aber ich bin auch dazu bereit, nochmal einen Schritt zurückzugehen und das dann einzusehen.'
Sozialer
Verein
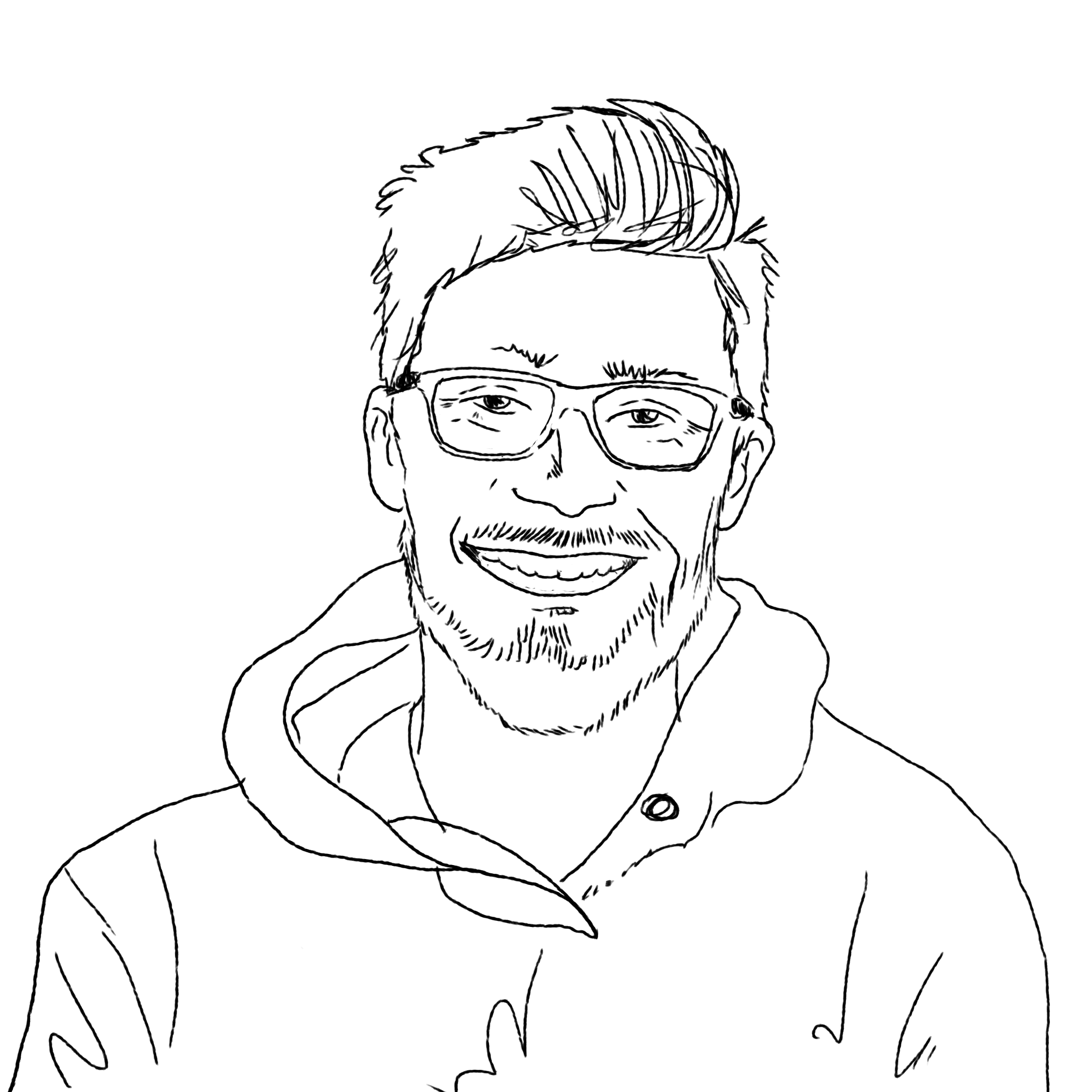
Ebene der
Begegnung
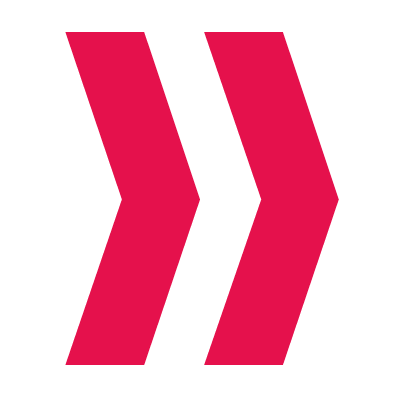
Jeder bringt bei unseren Treffen mal 'ne Flasche Wein mit oder ich gebe ein Bier aus, oder einen Sekt. Es ist ungefähr 80% wird gearbeitet und 20% wird getratscht. Das ist ganz wichtig, über alles Mögliche zu reden, und dann sind die verschiedenen Positionen gar nicht mehr verschieden, da man sich im Grunde genommen ja versteht.
Nachbarschafts-
initiative
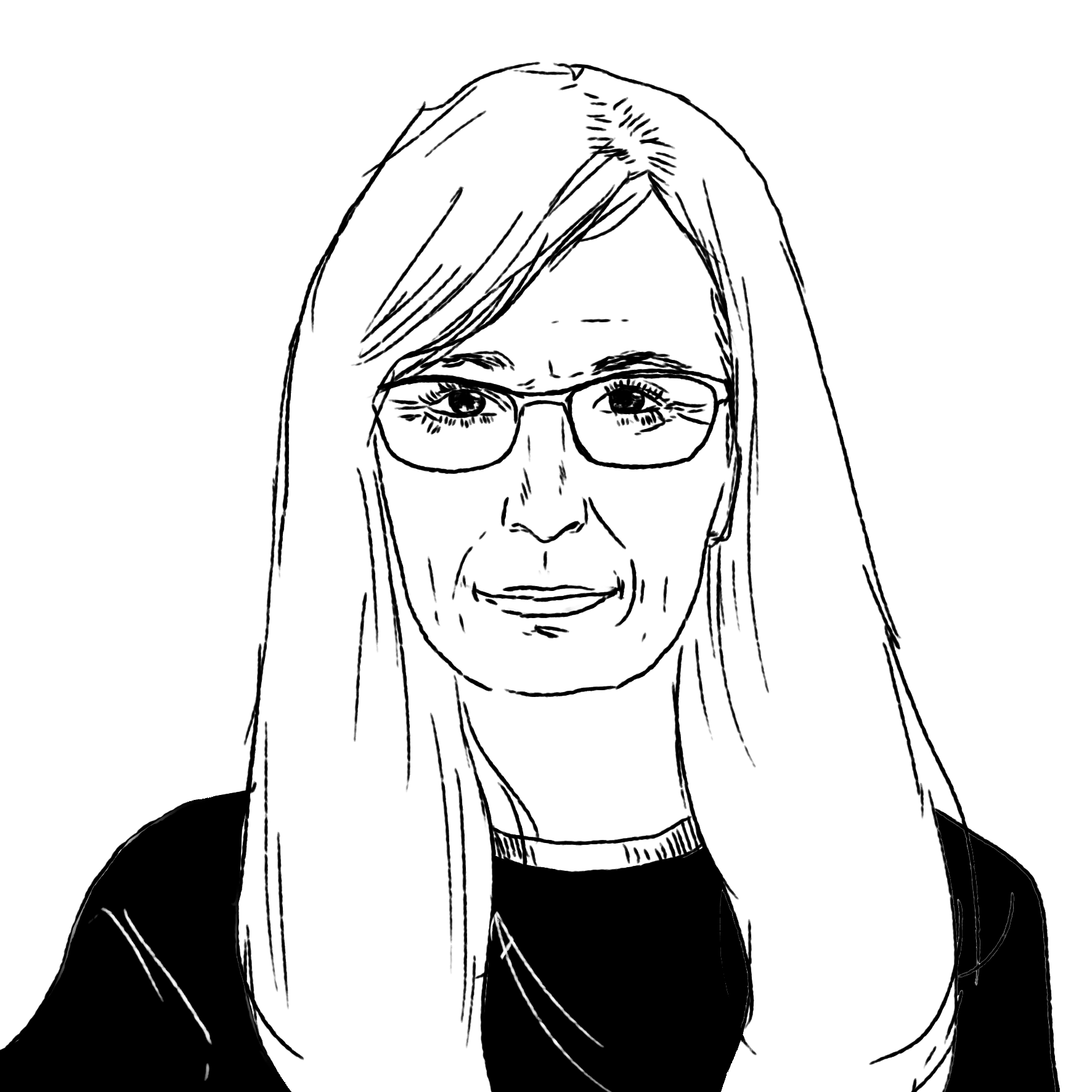
Warum das Zusammenkommen in unserer Gruppe gelingt, ist wahrscheinlich, wenn diese ganze Thematik plötzlich ein Gesicht und eine Geschichte bekommt. Dann kann ich mein eigenes Denken überwinden, weil ich eben eine Geschichte dahinter sehe.
Nachbarschafts-
treff
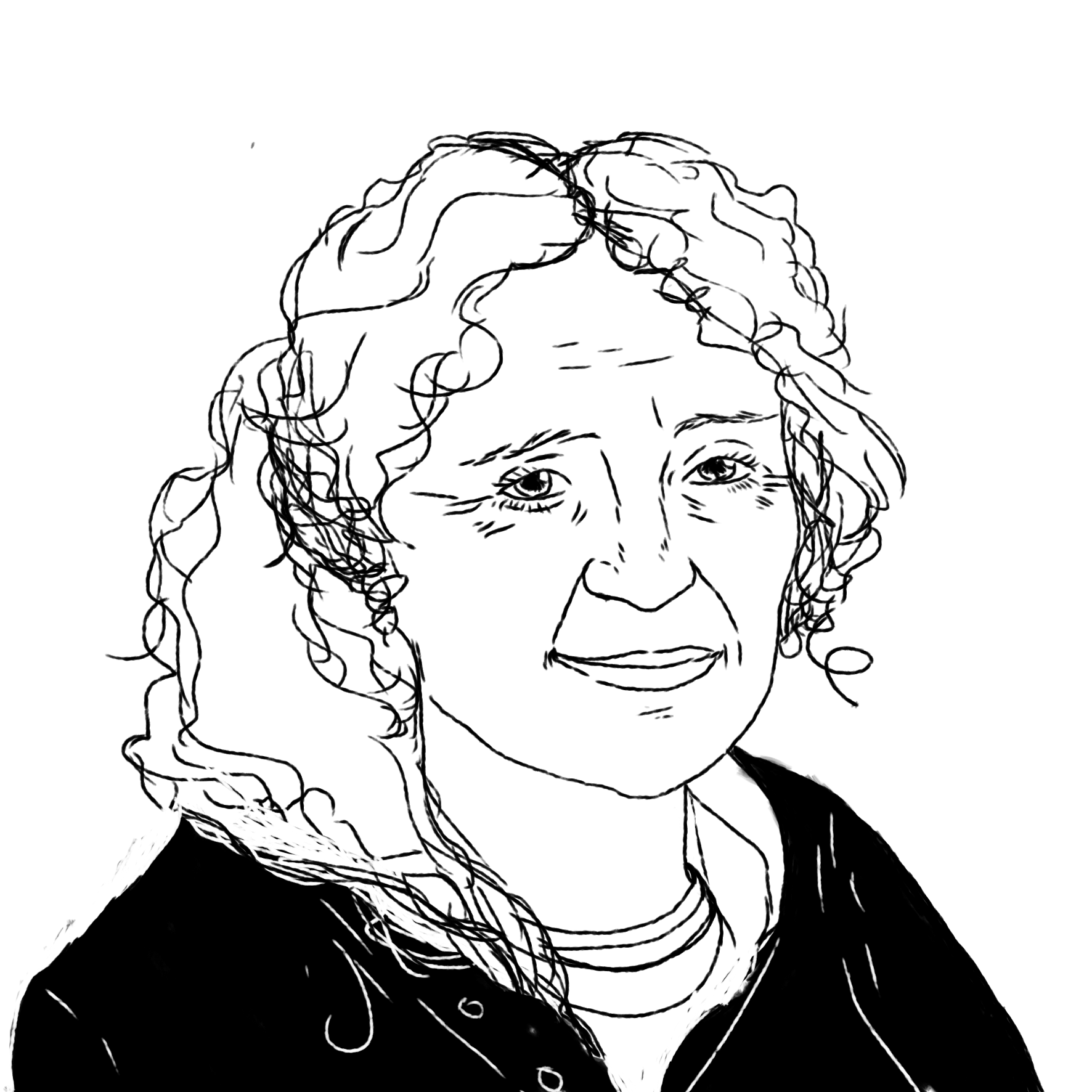
Die Leute waren mit zu Weihnachten, also die Geflüchteten waren mit bei den Geburtstagsfeiern zu Hause. Natürlich kamen andere aus anderen Bereichen der Stadt mit dazu und sind sich dort mit denen begegnet. Teilweise Leute, die bekannt dafür sind, dass sie eine ganz andere Haltung haben und bisher sehr ablehnend waren.
Religions-
gemeinschaft
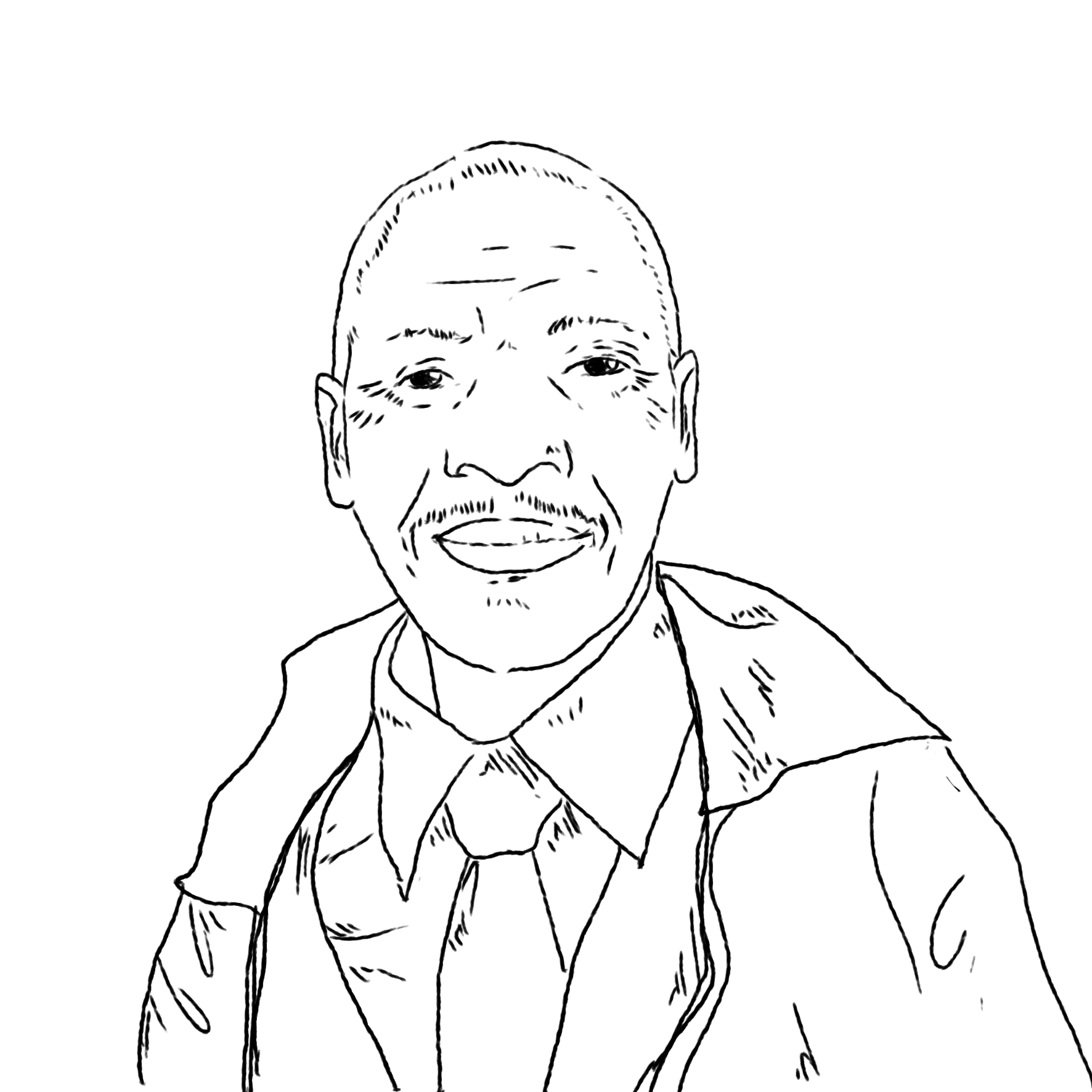
Ebene der Reflexion und emotionalen Auslastung
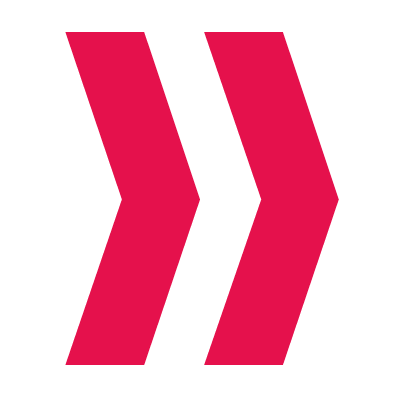
Also, wenn‘s kritisch wird, gehen meistens die Raucherinnen wieder runter und dann war das Problem eigentlich weg. Ich glaube, das ist auch schon so diese Streitfähigkeit, dass man sagt: ,Ich stehe jetzt zu meiner Meinung, aber ich bin auch dazu bereit, nochmal einen Schritt zurückzugehen und das dann einzusehen.'
Sozialer
Verein
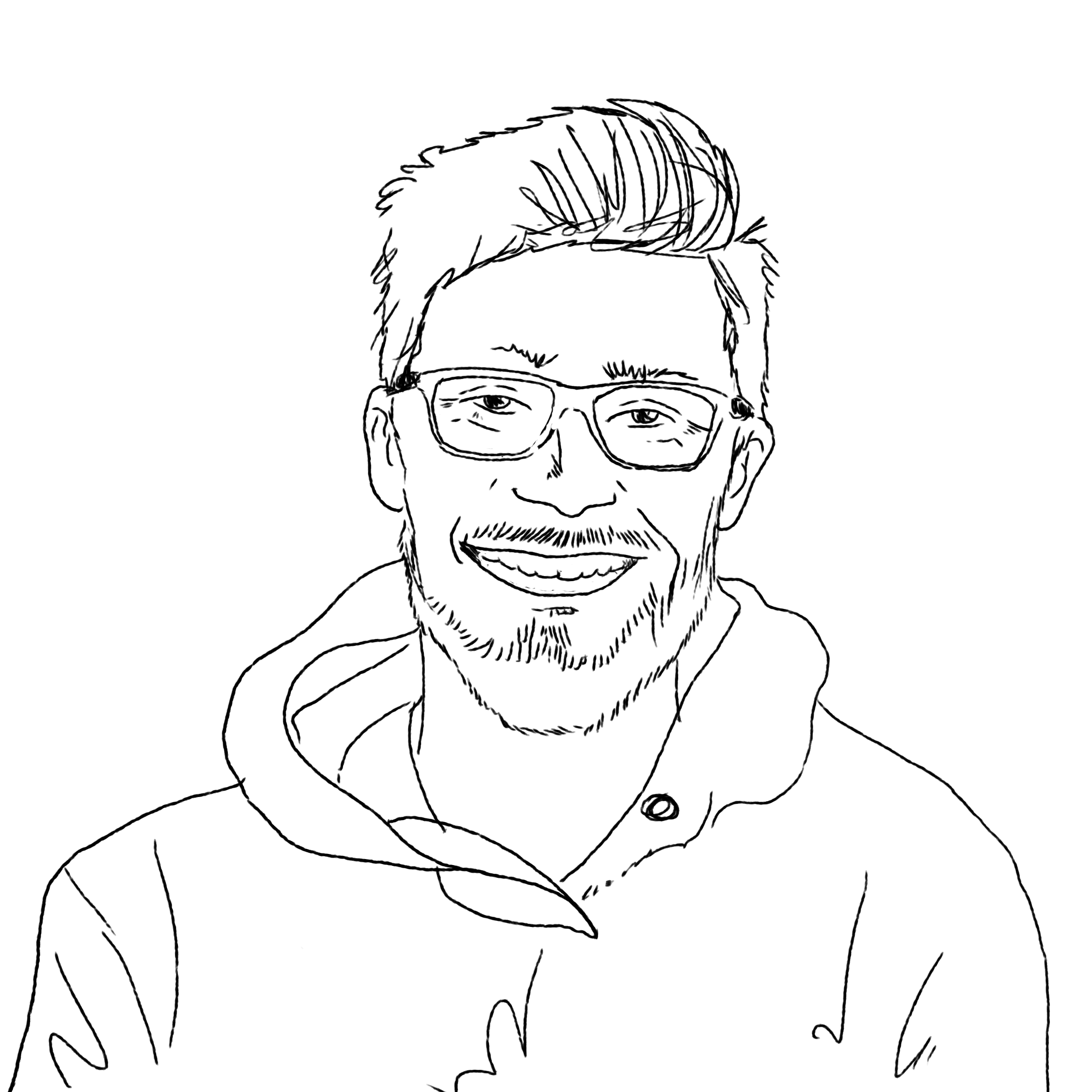
These 4:
Der Zusammenhalt zwischen Gruppenmitgliedern mit unterschiedlichen Ansichten und Hintergründen wird durch das Zusammenwirken von drei Begegnungsebenen hergestellt.
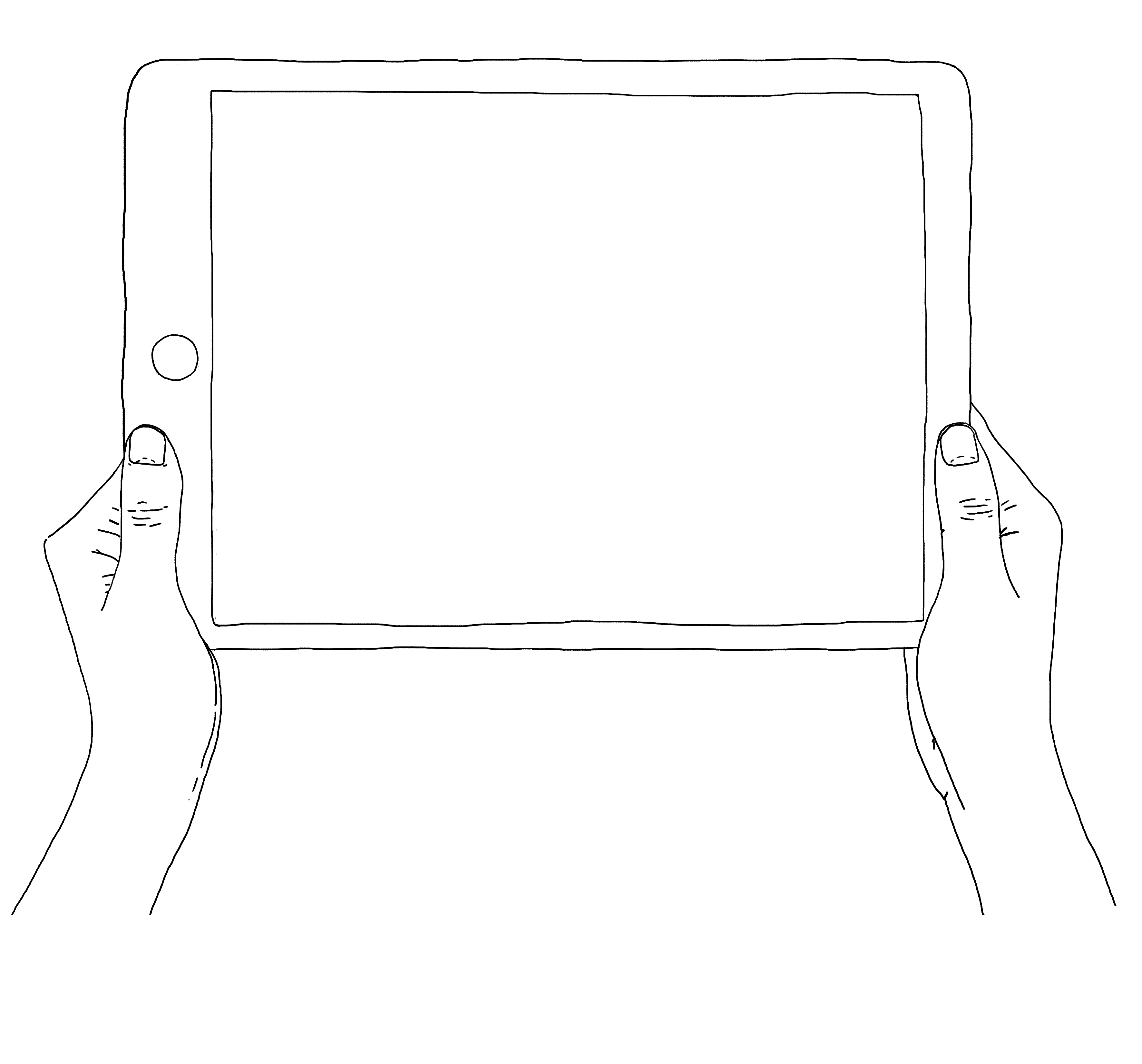
These 4
Der Zusammenhalt zwischen Gruppenmitgliedern mit unterschiedlichen Ansichten und Hintergründen wird durch das Zusammenwirken von drei Begegnungsebenen hergestellt.
Ebene der Zusammenarbeit
(umfasst die ganze Gruppe: Plenum, Arbeitstreffen, Fußballfeld)- "öffentliche Hauptbühne" der Gruppe
- Arbeit an gemeinsamem Ziel
- Gruppenmitglieder vertreten verschiedene Rollen und Meinungen
- jede Aktivität ist für alle Gruppenmitglieder sichtbar
- hohes Konfliktpotential durch unterschiedliche Interessen der Gruppenmitglieder
Ebene der Begegnung
(umfasst die ganze Gruppe: gesellige Treffen, gemeinsame Ausflüge, Umkleidekabine)- Bietet Raum und Gelegenheit für ein presönliches Kennenlernen
- Überwindet die „Sprachlosigkeit“ der Polarisierung
- Gruppenmitglieder können sich von ihren „öffentlichen“ Rollen distanzieren
- Fronten können sich öffnen
Ebene der Reflexion und emotionalen Entlastung
(umfasst einzelne persönliche Vertrauenspersonen: Rauch- und Toilettenpausen, gemeinsamer Weg zum Auto)- Rückzugsorte, um sich von konflikthaften Momenten zu erholen
- Emotionale und räumliche Distanz machen es einfacher, eigene Positionen zu überdenken, ohne das Gesicht zu verlieren

Trotz der gefühlten gesellschaftlichen Spaltung gibt es in Bautzen verschiedene ehrenamtliche Gruppen, in denen Bautzenerinnen und Bautzener sich über politische, ideologische, kulturelle und soziale Lager hinweg – zum Teil auch mühevoll - zusammenfinden und eine Kultur des Zusammenhalts und gemeinsamer Lösungsfindung erhalten oder geschaffen haben. Solche Gruppen werden in der Fachliteratur Mikro-Öffentlichkeiten (engl. micro publics) genannt. Wir fanden sie in den verschiedensten ehrenamtlichen Organisationsformen, vom eingetragenen Verein über bürgerschaftliche Initiativen bis hin zu losen Netzwerken. Gemein sind ihnen das solidarische Interesse und der Gestaltungswille an einem gemeinsamen Ziel.
Ehrenamtliche Organisationsformen wie Vereine sind traditionell Orte, an denen Konflikte ausgehandelt werden und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Dort treffen Menschen mit verschiedensten Hintergründen aufeinander. Sie können sich hier – anders als oftmals im politischen Geschehen empfunden – einbringen und Konflikte selbstbestimmt aushandeln. Wir nehmen ehrenamtliche Organisationen daher als Ausgangspunkt, um zu fragen, wie Menschen über die gespaltenen Lager in Bautzen hinweg in Kommunikation, Austausch und Aushandlung kommen können. Wir fragen, an welchen Orten und unter welchen Umständen diese Aushandlungskultur bereits stattfindet und wie diese darüber hinaus gefördert werden kann.
Ausgangslage
Die Stadt
Bautzen
Bautzen ist eine Große Kreisstadt und mit rund 38.000 Einwohner:innen [1] ein Teil des Oberzentralen Städteverbunds „Bautzen-Görlitz-Hoyerswerda“ in Ostsachsen. In der Lausitz gelegen – dem größten Braunkohlerevier der DDR – ist die Stadt nach der politischen Wende direkt vom Kohleausstieg und Strukturwandel betroffen. Die soziale, demografische und infrastrukturelle Erosion der Region, die in den 1990er Jahren folgt und mit Abwanderung, Finanzschwäche und Verwaltungsumbau einhergeht, ist vielen Bautzener:innen als fremdbestimmter Strukturbruch im kollektiven Gedächtnis geblieben.
Mit ihrer Lage im Dreiländereck Polen-Tschechien-Deutschland und als politisches und kulturelles Zentrum der Sorbinnen und Sorben blickt sie auf eine lange interkulturelle Geschichte zurück. Indes steigt der Ausländer:innenanteil in Bautzen zwischen 1991 und 2011 nur unwesentlich von 0,9 % auf 1,7 %. Mit dem vermehrten Zuzug von Geflüchteten ab 2015 erhöht sich der Anteil an Einwohner:innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft innerhalb kurzer Zeit auf 4,4 % am 31. Dezember 2015, was 2.407 Personen entspricht. Nach dem Abschwächen des Zuzugs Geflüchteter nach Deutschland leben im Mai 2021 noch 1.253 Personen mit dem Status „Asyl“ im Landkreis Bautzen [2]. Bei den Kommunalwahlen 2019 tritt die AfD in Bautzen erstmalig zur Wahl an und wird mit 23,2 % die zweitstärkste Partei im Stadtrat (CDU: 24,4 %) [3].
[1] Online abgerufen am 20.06.2021 unter: https://www.statistik.sachsen.de/download/aktuelle-zahlen/statistik-sachsen_aI1_einwohnerzahlen-monat.xlsx
[2] Online abgerufen am 20.06.2021 unter: https://www.landkreis-bautzen.de/download/Auslaenderamt/Asyl_Unterbringung_2021_05.pdf
[3] Online abgerufen am 03.12.2021 unter: https://www.bautzen.de/fileadmin/media/statistik_wahlen/Wahlbericht-Stadtrat-2019.pdf
1.
Wie sind Mikro-Öffentlichkeiten gestaltet und wie können sie verbindend auf ihre unterschiedlichen Mitglieder wirken?
2.
Was können wir aus diesen Erkenntnissen für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts lernen?
Forschungs-
fragen
Schluss-
folgerungen
Während die Stadt Bautzen in den letzten Jahren medial oft einseitig als Beispiel für Ausschreitungen, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland und Sachsen dargestellt wurde, sehen wir stattdessen eine vielfältige Stadtgesellschaft vor der Zerreißprobe. In den vergangenen Jahren kam es zu einem Prozess der zunehmenden Lagerbildung und Entfremdung innerhalb der Stadtgesellschaft, der sich ab 2015 entlang der Haltungen zur bundesweiten Zuwanderungspolitik entzündete. Die zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, die sich für Zugewanderte einsetzen, fühlen sich von Teilen der Bürgerschaft als „Linke“, als naiv und weltfremd gebrandmarkt. Gleichzeitig meiden konservative und bürgerschaftliche Akteur:innen das Themenfeld, um nicht auch in diese Ecke gedrängt zu werden. Unsere Gesprächspartner:innen zeigen, dass politische Orientierungen in Bautzen vielfältig sind und sich nicht allein anhand eines Rechts-Links-Schemas abbilden lassen. Trotz der von den Bautzenerinnen und Bautzenern stark empfundenen politischen Lagerbildung der Stadtgesellschaft, konnten wir in Bautzen verschiedene ehrenamtliche Gruppen, wie Vereine, Initiativen und lose Netzwerke finden, in denen sich Menschen über politische, ideologische, kulturelle und soziale Lager hinweg – zum Teil auch mühevoll - zusammenfinden und an gemeinsamen Zielen arbeiten. Diese Mikro-Öffentlichkeiten genannten Gruppen sind keine Garanten für die Vermittlung zwischen den Lagern. Dennoch hat sich gezeigt, dass sie bestimmte Eigenschaften aufweisen, die für eine Begegnung von Menschen aus verschiedenen politischen oder ideologischen Lagern auf Augenhöhe förderlich sein können. Wir gehen davon aus, dass es nicht per se problematisch ist, dass es unterschiedliche Positionen in der Stadtgesellschaft gibt, solange die Beteiligten noch ein gemeinsames Interesse vor Augen haben. So wurde deutlich, dass ein gemeinsames, verbindendes Ziel in Mikro-Öffentlichkeiten zum Zusammenhalt und zur Aushandlungsbereitschaft der Beteiligten beitragen kann. Wichtig dabei ist es, deutlich zu machen, was die Regeln des gemeinsamen Umgangs sind und auf deren Einhaltung zu achten.
Mikro-Öffentlichkeiten scheinen auf eine spezielle Art und Weise gestaltet zu sein, in der die Aushandlungen zwischen den unterschiedlichen Mitgliedern auch in Konfliktfällen ermöglicht werden kann und der Zusammenhalt der Gruppe bestehen bleibt. Wir beobachten drei unterschiedliche Ebenen, auf denen die Mitglieder einer Mikro-Öffentlichkeit untereinander kommunizieren. Erstens die Ebene der Zusammenarbeit, zweitens die Ebene der Begegnung und drittens die Ebene der Reflexion und emotionalen Entlastung. Gerade die Ebene der Begegnung sowie die Ebene der Reflexion und emotionalen Entlastung sind offenbar das Zünglein an der Waage für die Dynamik, die sich in einer konflikthaften Situation entwickelt. Beispielsweise braucht es neben der ‚Hauptbühne‘ auch die Nebenschauplätze wie die Umkleidekabine, oder das Gespräch beim Glas Wein nach der Vereinssitzung, wo die Beteiligten sich ohne größere Öffentlichkeit auch persönlich begegnen können. Als verbindende Kraft der Mikro-Öffentlichkeiten sehen wir Strukturen, die es ermöglichen, eine persönlichere Begegnung unter den verschiedenen Mitgliedern herzustellen, die Vertrauen schaffen und dazu beitragen können, die anderen Konfliktbeteiligten und ihre Motive zu hören und zu verstehen und sich selbst mit den eigenen Motiven wahrgenommen zu fühlen. Erst so wird es für alle Beteiligten verständlicher, was passiert und was in den Konflikt hineinspielt. Denn aus unserer Forschung wissen wir, dass in Konfliktkonstellationen unterschiedlichste Faktoren zusammenwirken und sich an einem Gegenstand entladen können (u.a. Budnik et al. 2020). Es braucht also auch Gespräch über die anderen Konflikte, die auf der Hauptbühne keinen Platz haben.
Eine zentrale Stärke der Mikro-Öffentlichkeiten ist zudem die regelmäßige Begegnung der Mitglieder. Wir glauben, dass dadurch auch das Gespräch „zwischen den Lagern“ am Laufen gehalten werden kann. Gleichwohl sehen wir die Gefahr, dass Mikro-Öffentlichkeiten zu den viel diskutierten Echokammern gegenseitiger Bestätigung werden, denn Begegnung heißt nicht gleich Aushandlung und Aushandlung heißt im Ergebnis nicht notwendigerweise demokratische Fortentwicklung.
ANREGUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE GRUPPEN IN KONFLIKHAFTEN SITUATIONEN
Klären Sie, welche gemeinsamen Ziele Sie verfolgen und warum es sich lohnt, Spannungen in der Gruppe auszuhalten.
Treffen Sie sich regelmäßig in nicht all zu weiten Abständen, um den Kontakt zueinander nicht zu verlieren.
Verbinden Sie das Nötige mit dem Geselligen und lernen Sie sich und Ihre Perspektiven untereinander auch persönlich kennen.
Achten Sie darauf, dass die Entscheidungen in Ihrer Gruppe für alle transparent und nachvollziehbar getroffen und kommuniziert werden.
Einigen Sie sich auf gemeinsame Routinen und ggf. darauf, welche Gesprächsregeln bei Ihnen gelten und wie Sie Konflikte miteinander bearbeiten möchten.
Etablieren Sie ggf. Pausen oder Rückzugsorte, in die sich einzelne Personen in konflikthaften Momenten kurz zurückziehen können.

Unter Mikro-Öffentlichkeiten verstehen wir Gruppen, die sich aus Menschen mit verschiedenen politischen, ideologischen, kulturellen, sozialen oder ökonomischen Hintergründen zusammensetzen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Typische Mikro-Öffentlichkeiten sind Vereine, Jugend-Center, Sport-Klubs oder religiöse Gemeinden.
Mikro-Öffentlichkeiten bieten die Möglichkeit für ihre Mitglieder, aus festen Mustern des gegenseitigen Umgangs auszubrechen und neue Arten der Beziehungen untereinander zu entwickeln. Durch das persönliche Kennenlernen „der Anderen“ kann ein gegenseitiges Verständnis untereinander aufgebaut werden.
Kurzinfo zu Mikro-Öffentlichkeiten
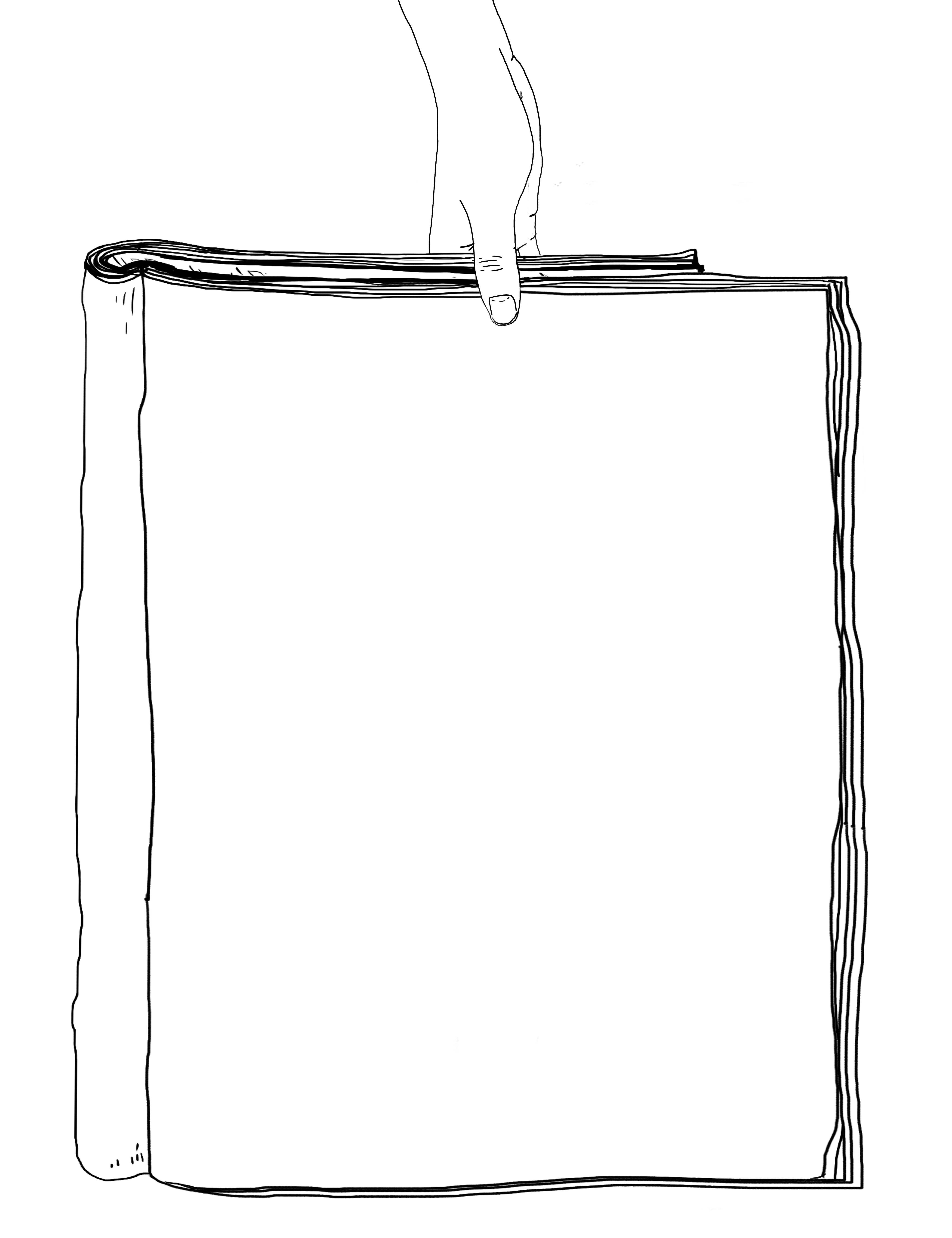
THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZU MIKRO-ÖFFENTLICHKEITEN
Das Wort „Mikro-Öffentlichkeiten“ (engl. micro publics) stammt aus der britischen Sozialgeographie. Ihnen wird eine besondere Bedeutung für den Zusammenhalt verschiedener Gesellschaftsgruppen (vgl. Amin 2002) sowie eine stärkende Wirkung auf das Zusammenleben verschiedener Kulturen zugeschrieben (vgl. Valentine 2008: 324 f.).
Sie sind Orte gezielt organisierter Gruppenaktivitäten, an denen Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen zusammenkommen. Sie bieten ihren Mitgliedern die Möglichkeit, aus festen Interaktionsmustern auszubrechen und so neue Arten der Beziehungen untereinander zu entwickeln (vgl. ebd.: 331). Der Blick dieser Arbeiten richtet sich auf Aushandlungen und Verständigungsprozesse über soziale Differenzen hinweg, die oft innerhalb von Nachbarschaften stattfinden, denn „die Aushandlung von Unterschieden erfolgt auf lokaler Ebene durch alltägliche Erfahrungen und Begegnungen“ (Amin 2002: 959).
Mikro-Öffentlichkeiten werden als integrative Alleskönner besprochen: Sie können demnach Brücken über soziale Grenzen hinweg schaffen (vgl. ebd.), sie verhandeln gemeinsame Normen und Erwartungen, die den Umgang miteinander regeln (vgl. Valentine 2008: 329) und können emanzipativ und empowernd auf ihre Mitglieder wirken (vgl. Hrycak, Rewakowicz 2009). Valentine sieht die integrative Kraft dieser Öffentlichkeiten in deren Möglichkeit, einen bedeutungsvollen Kontakt (engl. meaningful contact) zwischen den Mitgliedern verschiedener sozialer Gruppen herzustellen. Damit meint sie „einen Kontakt, der tatsächlich Werte verändert und über den jeweiligen Moment hinaus einen allgemeineren positiven Respekt – und nicht nur Toleranz – für Andere bedeutet“ (Valentine 2008: 325, eigene Übersetzung). Als verbindendes Element solcher vielfältigen Gruppen werden gemeinsame Interessen und das Engagement für geteilte Ziele durch gemeinsame Aktivitäten beschrieben (vgl. Amin 2002).
Vereine und zivilgesellschaftliche Institutionen werden häufig als Orte benannt, an denen dieser bedeutungsvolle Kontakt entsteht. Vereine stehen auch im Fokus vieler Forschungen im deutschsprachigen Raum. So zeigen Studien zu Vereinen einen deutlich „positiven Zusammenhang zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“ (Koch, Boehnke 2016: 17). Durch zivilgesellschaftliches Engagement wird oftmals ein „progressiver, demokratiefördernder Effekt“ erwartet (Grande 2018: 54). Jedoch gibt es in der Zivilgesellschaftsforschung widersprüchliche Einschätzungen dazu. Dort wird zum Teil auch von der „unzivilen Zivilgesellschaft“ (Chambers, Kopstein 2001, eigene Übersetzung) oder der „dunklen Seite der Zivilgesellschaft“ (Lenhardt, Roth 2017) gesprochen. Demnach sind zivilgesellschaftliche Institutionen „keineswegs in Gänze gewalt- oder herrschaftsfrei oder auf Toleranz und Verständigung gestimmt. Sie enthalten auf ihrer ‚dunklen Seite‘ sogar Zusammenschlüsse, die zivilgesellschaftlichen Normen ambivalent gegenüberstehen, sie offensiv bekämpfen oder durch Exklusivität in Frage stellen“ (ebd.: 621).
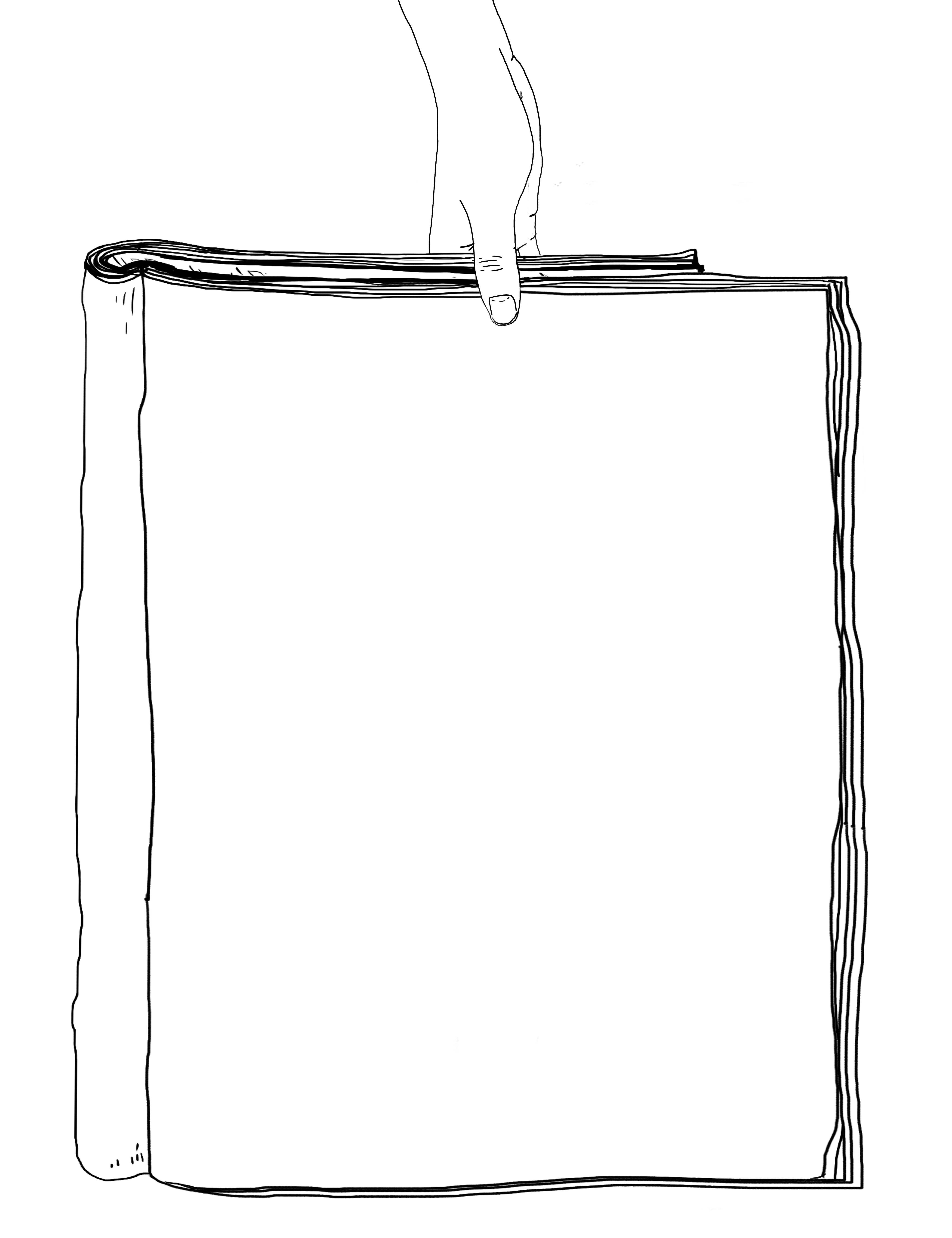
Wissenschaftliche Literatur
Ash Amin, 2002: Ethnicity and the Multicultural City: Living with Diversity. Environment and Planning, volume 34, 959-980.
Simone Chambers, Jeffrey Kopstein, 2001: Bad civil society. In: Political theory, 29. Jg., H. 6., 837-865.
Edgar Grande, 2018: Zivilgesellschaft, politischer Konflikt und soziale Bewegungen. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen - Analysen zu Demokratie und Zivilgesellschaft, Jg. 31, H. 1-2, 52-59.
Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, 2009: Feminism, Intellectuals and the Formation of Micro-Publics in Postcommunist Ukraine. Studies in East European Thought, volume 61, 309-333.
Michael Koch, Klaus Boehnke, 2016: Kann Bürgerschaftliches Engagement den Zusammenhalt in Deutschland fördern?. In: Wolfgang Stadler (Hrsg.): Mehr vom Miteinander - Wie bürgerschaftliches Engagement den sozialen Zusammenhalt stärken kann. Theorie und Praxis der sozialen Arbeit. Sonderband 2016. 10-20. Weinheim.
Karin Lenhart, Roland Roth, 2017: Anti-Diskriminierung als zivilgesellschaftliches Projekt. In: Handbuch Diskriminierung. 615-637. Wiesbaden: Springer.
Gill Valentine, 2008: Living with Difference: Reflections on Geographies of Encounter. Progress in Human Geography, 32(3), 323- 337.
Karin Lenhart, Roland Roth, 2017: Anti-Diskriminierung als zivilgesellschaftliches Projekt. In: Handbuch Diskriminierung. 615-637. Wiesbaden: Springer.
Gill Valentine, 2008: Living with Difference: Reflections on Geographies of Encounter. Progress in Human Geography, 32(3), 323- 337.
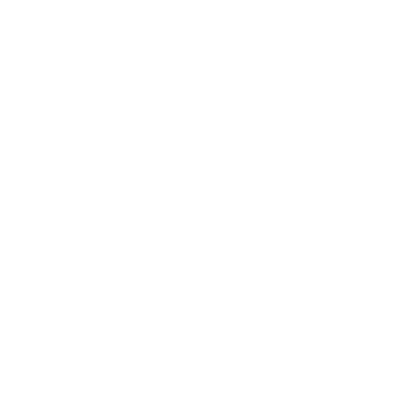 Gespräche und Erkenntnisse
Gespräche und Erkenntnisse


.jpg)

