Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Konflikten

In unseren Gesprächen mit ehrenamtlichen Gruppen in Bautzen wurde uns häufig beschrieben, dass eine
Lagerbildung innerhalb der Stadtgesellschaft entlang konflikthafter Fragen, wie z.B. der Zuwanderungspolitik
oder der Maßnahmen für die Eindämmung der Covid19-Pandemie, als starke Belastung empfunden wird. Konflikte
werden nicht mehr offen angesprochen, die Stimmung in der Gruppe lässt keine konstruktive Arbeit mehr zu,
Stellvertreter:innenkonflikte entstehen. Dies kann sogar dazu führen, dass Mitglieder die Gruppe verlassen.
In diesem Teil unserer Website greifen wir exemplarische Probleme auf, die uns während unserer Arbeit
geschildert wurden. Dafür bitten wir Konfliktberaterinnen des
„Kompetenzzentrums Kommunale Konfliktberatung
des Vereins zur Förderung der Bildung – VFB Salzwedel e.V.“ um eine kurze Einordnung solcher Probleme sowie
um einen Impuls, wie Einzelne oder auch Gruppen einen Umgang damit finden können.

Frage
Wir haben das Gefühl, dass wir uns als Gruppe zu den großen politischen Debatten positionieren müssen. Unsere Kooperationspartner:innen und unser Umfeld erwarten, dass wir Stellung dazu beziehen, aber wir haben in der Gruppe keinen Konsens dazu oder sehen unsere Arbeit davon gefährdet. Wie können wir damit umgehen?
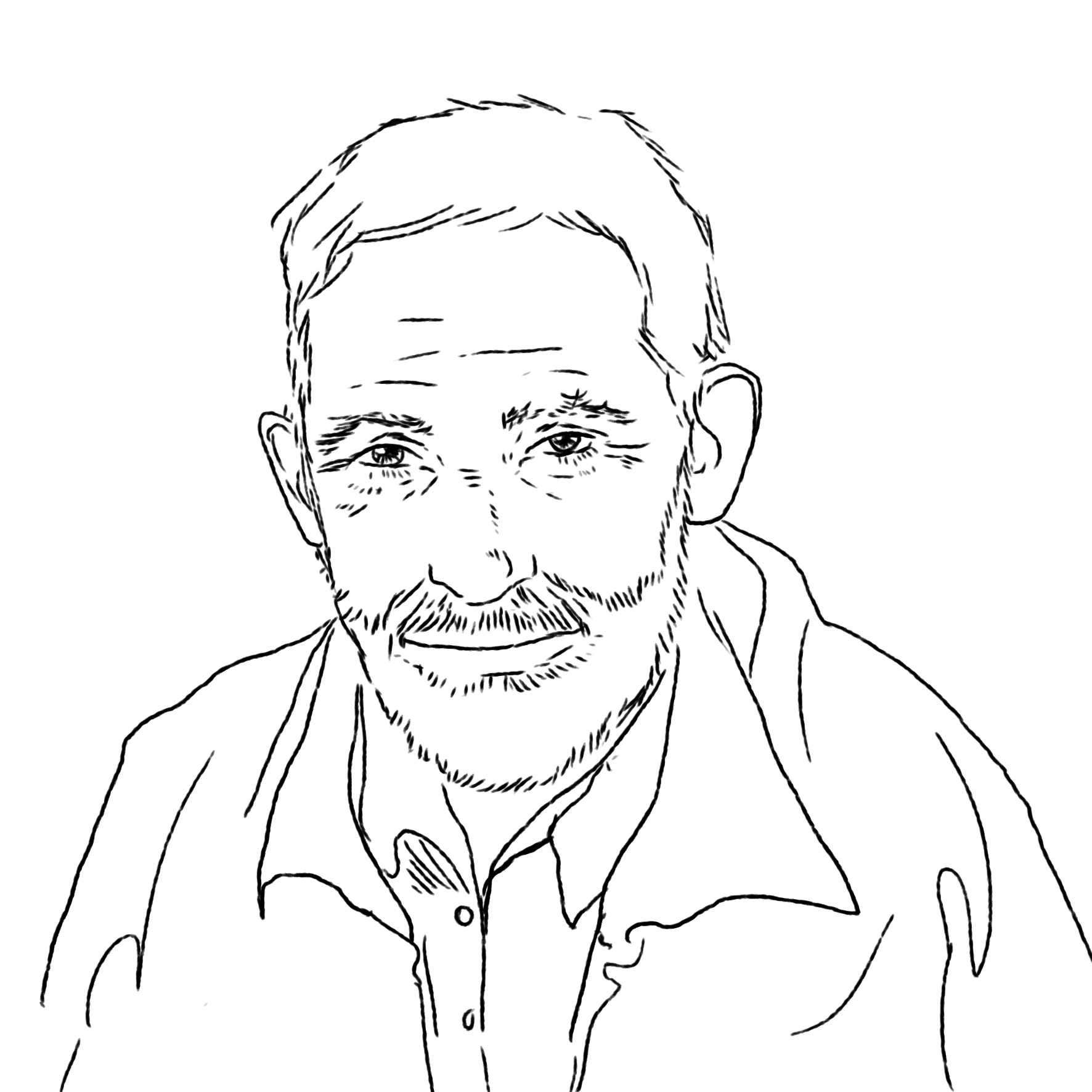
Impuls
Wir sehen das oft in Konflikten: Wenn sie eskalieren, wird der Druck auf Einzelne und Gruppen, Stellung
zu beziehen und sich einem Lager zuzuordnen, immer größer. Das ist eine Abwärtsspirale, weil es dadurch
immer schwieriger wird, auch über Lagergrenzen hinweg miteinander zu sprechen und Fragen des Zusammenlebens
auszuhandeln. Um mehr zu den Dynamiken hinter Konflikten zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, sich über die
Eskalationsstufen von Konflikten nach Friedrich Glasl zu informieren [1].
Unser Impuls: Machen Sie sich bewusst, woher der Druck kommt, sich zu positionieren. Manchmal ist es
tatsächlich notwendig, Stellung zu beziehen (z.B. wenn ein Geldgeber das verlangt). Manchmal ist man aber
auch in der oben beschriebenen Dynamik im Konflikt gefangen, die den Konflikt immer weiter eskalieren lässt.
Überlegen Sie, ob es wichtig ist, sich hier und jetzt zu positionieren. Welche Chancen oder Gefahren
liegen darin – für den Verein oder für Ihr Zusammenleben in der Stadtgesellschaft? Welche Möglichkeiten
haben Sie als Verein, aus der Konfliktdynamik auszusteigen?
[1] Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl:
https://de.wikipedia.org/wiki/Konflikteskalation_nach_Friedrich_Glasl
Kommunale
Konfliktberaterin
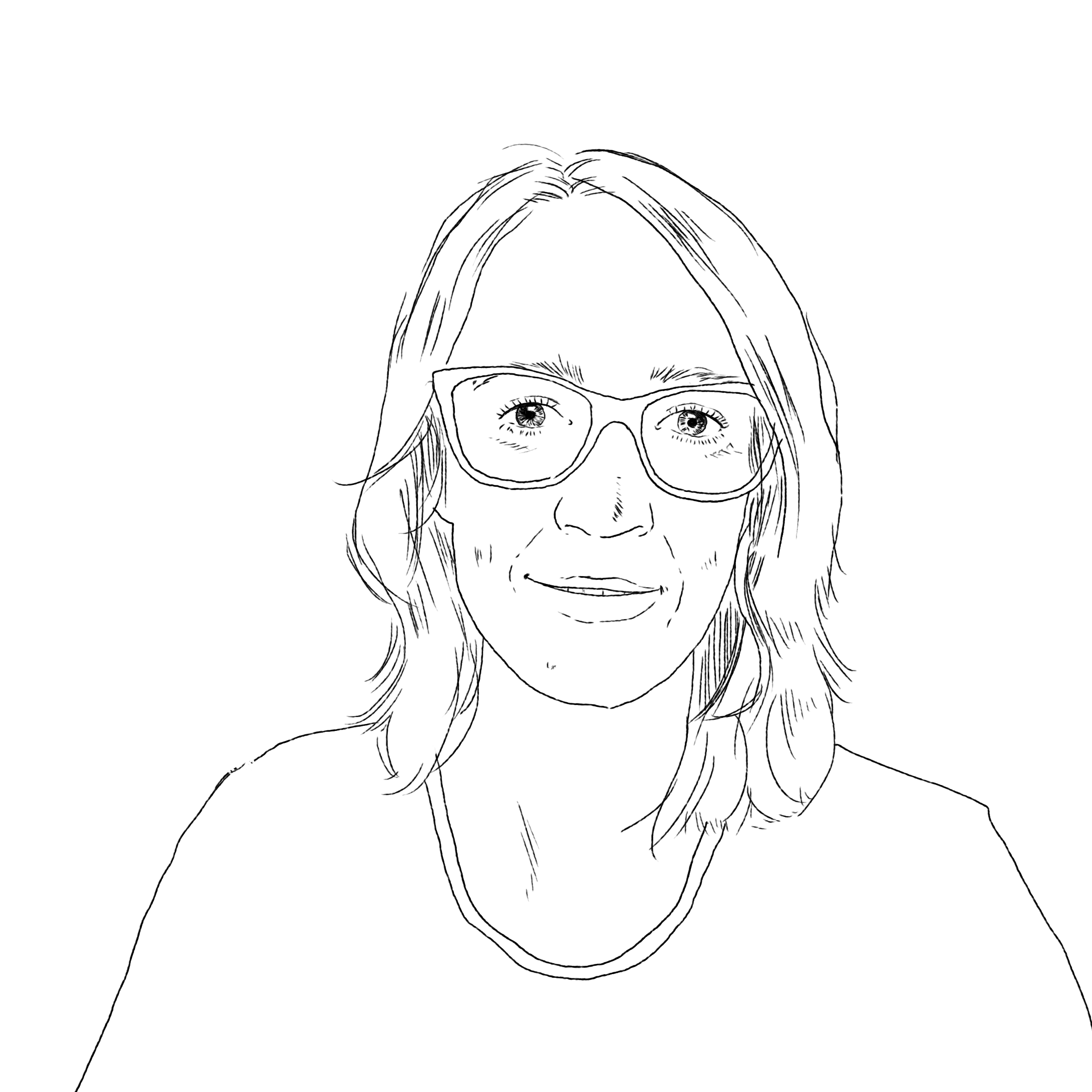
Impuls
Das ist nicht ungewöhnlich. Vereine leben von den Menschen, die sich engagieren. Diese Menschen sind
Bürger:innen einer Stadt und tragen Konflikte aus der Stadt in den Verein hinein. Wenn es gelingt, alle
mitzunehmen, können aus Konflikten neue gute Ideen für Ihre Gruppe entstehen. Wie Sie in Ihrem Verein
mit diesen Konflikten umgehen, kann eine Vorbildfunktion für die Stadtgesellschaft haben.
Unser Impuls: Holen Sie die Gruppe zusammen und sprechen Sie darüber, wie sie miteinander arbeiten und
umgehen möchten: Wie können wir alle mitnehmen? Wo setzen wir Grenzen? Was sind unsere gemeinsamen Ziele?
Wie wollen wir sie erreichen? Welche Regeln für den Umgang miteinander wollen wir uns geben?
Es kann auch helfen, ein Gegengewicht zu den Konflikten in der Gruppe zu setzen: Feiern Sie zum Beispiel
ganz bewusst Ihre gemeinsamen Erfolge. Das kann den Zusammenhalt stärken und bringt wieder Spaß in die Arbeit.
Kommunale
Konfliktberaterin
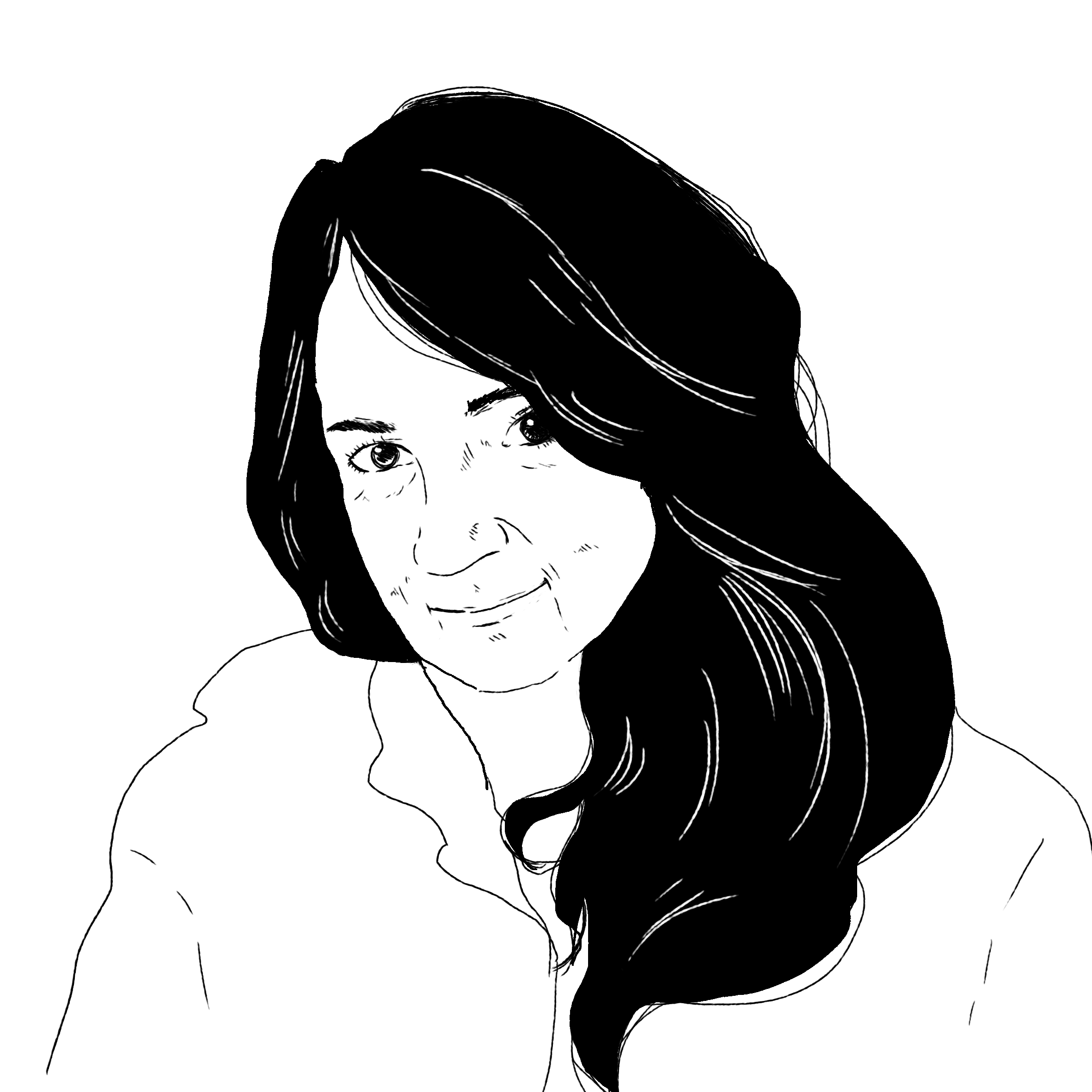
Frage
Wir zerstreiten uns über Themen, die nichts mit unserer Arbeit zu tun haben, oder vermeiden es, konflikthafte Themen anzusprechen. Unsere Gruppe kämpft damit, dass sich Leute verschiedenen politischen oder ideologischen Lagern zuordnen. Diese Auseinandersetzungen erschweren die Zusammenarbeit. Wie kann die Gruppe damit umgehen?
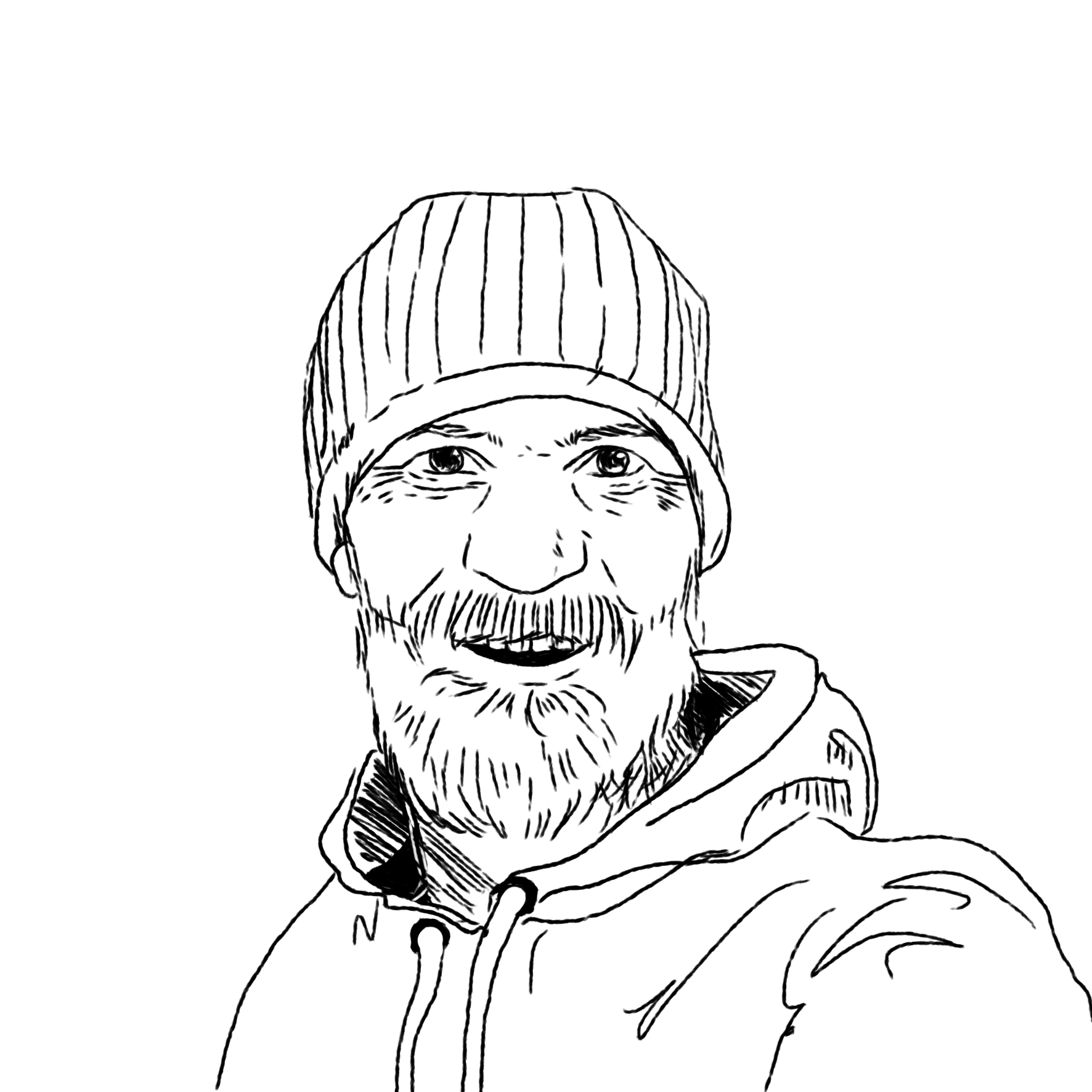
Frage
Einzelne dominante Gruppenmitglieder versuchen, die Gruppe unter Druck zu setzen, um die Arbeit des Vereins an ihrer persönlichen politischen Meinung auszurichten. Damit gefährden sie unseren Verein. Wie können wir damit umgehen?
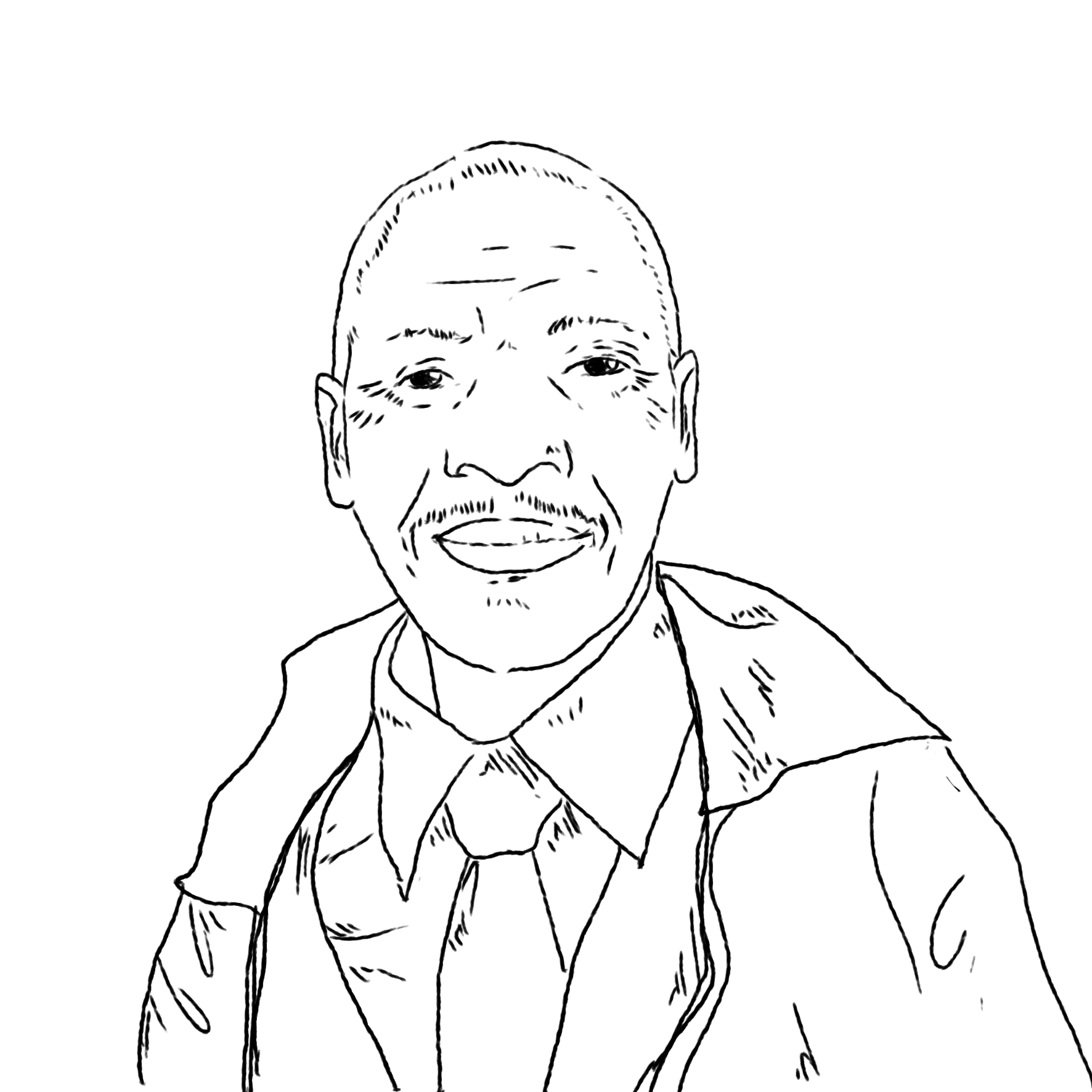
Impuls
Wenn Konflikte in einer Stadt eskalieren, können sich Lager bilden, die sich voneinander abgrenzen. Das
kann auch zu einer Zerreißprobe für Vereine werden, wenn sich einzelne Mitglieder als Vertreter:innen
dieser Lager verstehen und die Gruppe dominieren wollen.
Unser Impuls: Als Verein können Sie Einfluss nehmen auf diese Lagerbildung. Als Sportverein,
Nachbarschaftsinitiative oder Gesangsverein gestalten Sie das Zusammenleben in der Stadt und können zeigen,
dass Zusammenarbeit auch dann möglich ist, wenn Vereinsmitglieder unterschiedliche politische Meinungen
vertreten.
Um zu verhindern, dass Einzelne die Gruppe dominieren, verständigen Sie sich darüber, wie Sie in Ihrem
Verein Entscheidungen treffen möchten: Entscheidet der Vorstand, die Mehrheit der Mitglieder oder ist es
wichtig, dass jeder und jede Einzelne mitgehen kann? Gibt es feste Prozessabläufe wie z.B. Vereinssitzungen,
Antragsverfahren, Abstimmungsregeln? Mit klaren Abläufen, hinter denen alle stehen, können Sie dafür
sorgen, dass verschiedene Stimmen gehört werden.
Kommunale
Konfliktberaterin
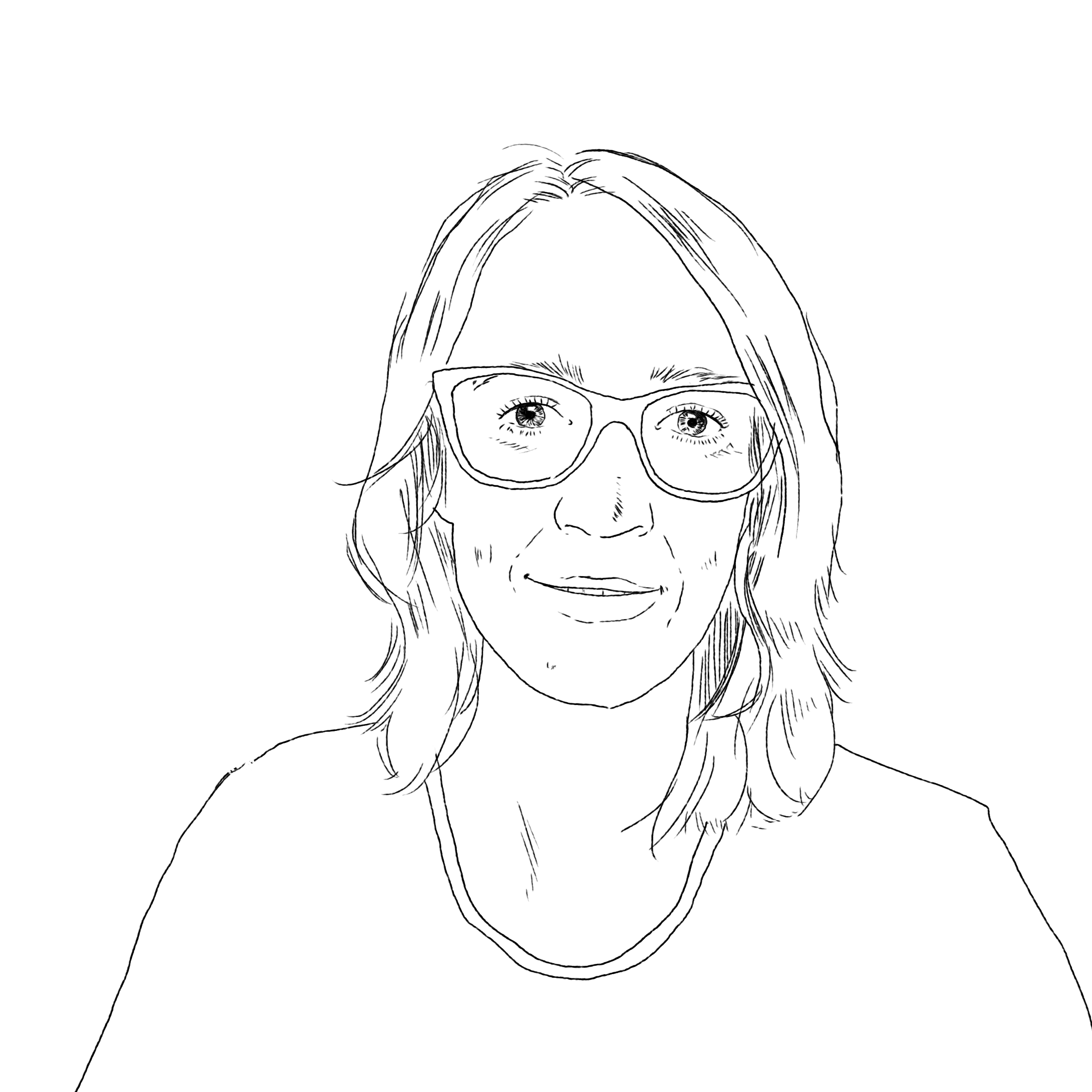
Impuls
Als Kommunale Konfliktberater:innen fragen wir uns hier, was in der Stadtgesellschaft passiert ist, dass
ein Gefühl von Angst und Bedrohung entstehen kann. Welche Ereignisse, Erfahrungen, Bilder und Berichte
tragen dazu bei, dass Sie sich in ihrer Stadt nicht mehr sicher fühlen?
Unser Impuls: Alleine werden Sie in einer solchen Problemlage nicht weiterkommen. Finden Sie heraus,
welche Unterstützungs- und Beratungsangebote und Ressourcen es in Ihrer Umgebung gibt, auf die Sie
zugreifen können. In vielen Gemeinden gibt es kommunale Präventionsräte, mobile Beratungsteams oder
Kontaktbeamte bei der Polizei, mit denen Sie darüber sprechen können, was in Ihrer Stadt passiert und wie
Sie mit dem Gefühl von Angst und Bedrohung durch gewaltbereite Gruppen umgehen können. Denken Sie gemeinsam
darüber nach, wer was tun kann. Wie kann sich dadurch die Atmosphäre in der Stadt verändern und
Meinungsvielfalt wieder möglich werden?
Kommunale
Konfliktberaterin
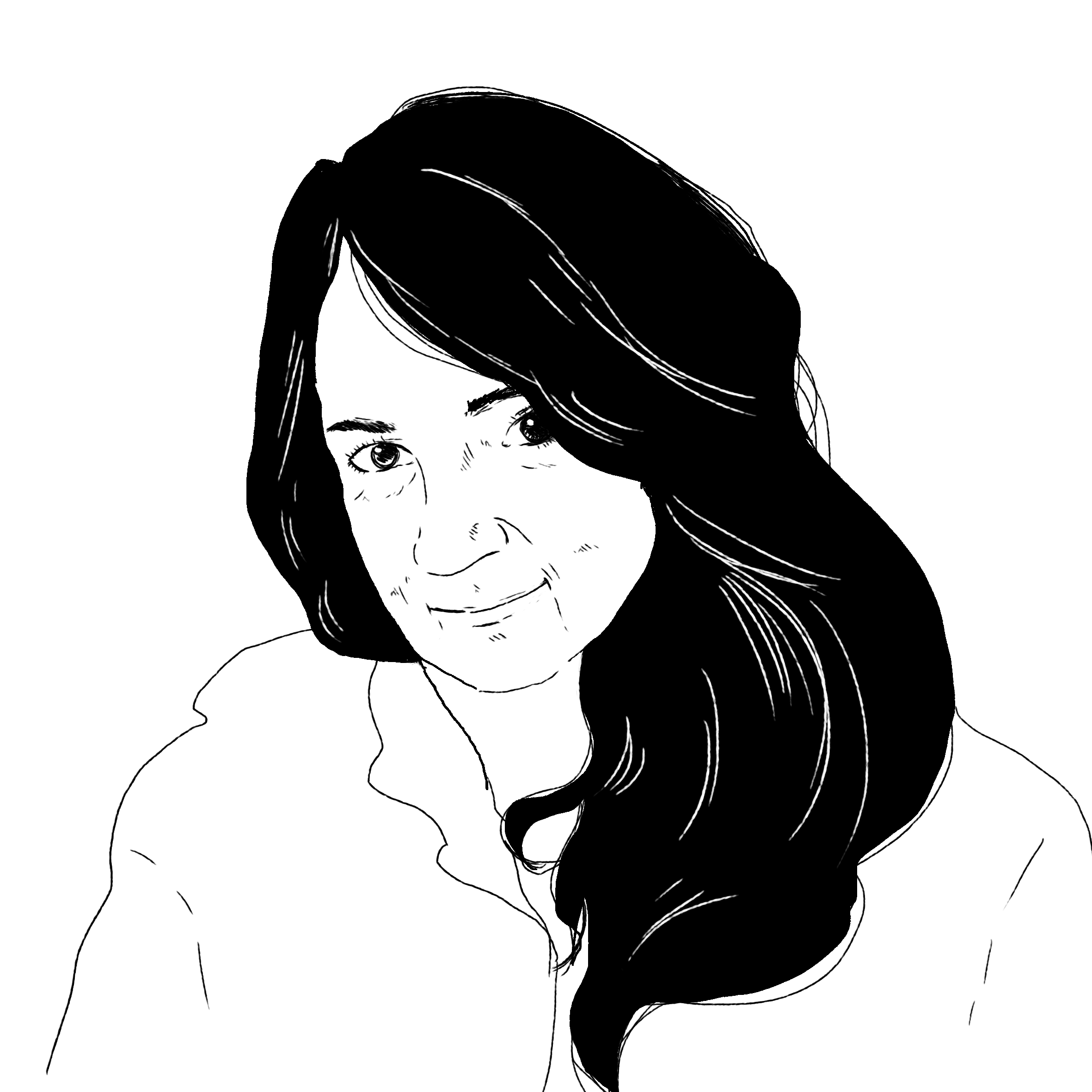
Frage
Bei uns gibt es gewaltbereite Gruppen, die mir Angst machen und ich schränke mein Engagement ein, um nicht in deren Fokus zu geraten. Das will ich aber eigentlich nicht. Wie komme ich hier weiter?
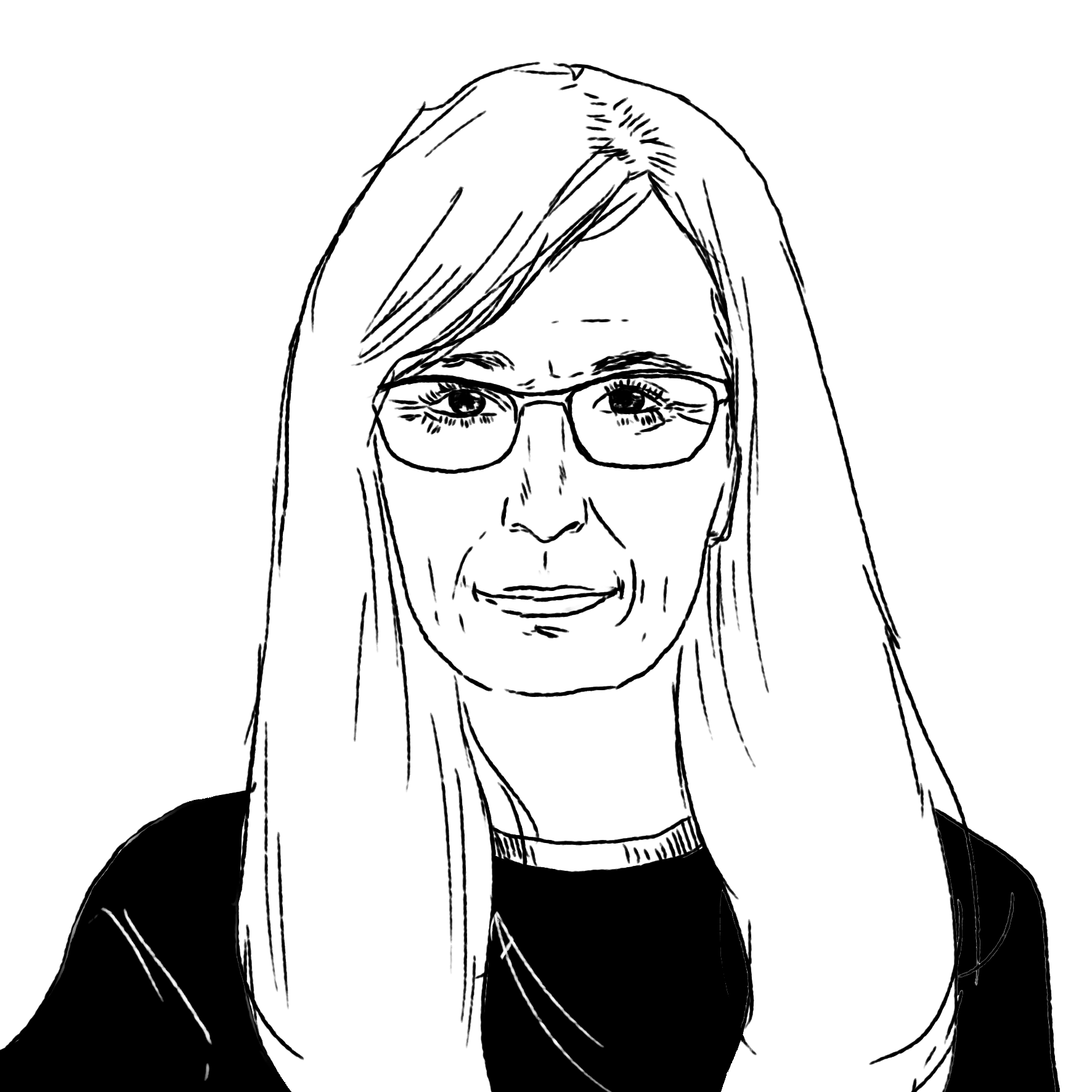

Schluss-
folgerungen
In jeder Gemeinde leben Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen und Bedürfnissen zusammen. Gleiches gilt in der Regel auch für Vereine und Initiativen. Diese Interessen und Bedürfnisse auszuhandeln, verschiedene Sichtweisen ernst zu nehmen und allen Beteiligten eine Teilhabe am Prozess der Entscheidungsfindung zu ermöglichen, wird immer mehr zu einer zentralen Aufgabe für ehrenamtliche Organisationen. Eine Voraussetzung dafür ist es, dass Akteur:innen in der Lage sind, bestehende Spannungen und Konfliktpotenziale wahrzunehmen, zu verstehen und zielgerichtet anzugehen. Je mehr Akteur:innen dabei an einem Strang ziehen und die Entscheidungen mittragen, desto nachhaltiger sind die gefundenen Lösungen.
Unsere Fragen stellen typische Konflikte dar, die uns in unserer Arbeit mit Ehrenamtlichen in Bautzen begegneten und sind nicht als abschließende Liste zu verstehen. Sie führen nicht zum Ende der Konflikte, sondern können als Ausgangspunkt dienen, um einen Prozess zur Auseinandersetzung mit den Konflikten zu starten. Um alle Beteiligten mitzunehmen, benötigen diese Prozesse in der Regel Zeit und eine intensive Auseinandersetzung. Als Betroffene:r fällt es oftmals schwer, sich diesen Dynamiken zu entziehen und einen „objektiven“ Blick auf die Konflikte zu entwickeln. Wir empfehlen Ihnen daher, sich externe Unterstützung zu suchen und sich ggf. mit lokalen Angeboten in Verbindung zu setzen. Ein weiterer Weg kann die Inanspruchnahme der Kommunalen Konfliktberatung sein.
Der methodische Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung untersucht die Hintergründe von Konflikten und Spannungen und nimmt dazu die Kommune als Ganzes in den Blick. Er geht davon aus, dass die Beteiligten selbst die Expert:innen für die Lösung ihrer Herausforderungen sind und unterstützt sie dabei. Dazu ist es wichtig, dass sie ihre eigene Sicht zur Sprache bringen können und sich gehört fühlen; dass sie in der Lage sind, die Hintergründe des Verhaltens anderer bzw. des Konfliktes und auch ihre eigene Rolle im Konflikt zu verstehen; und dass sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ernst genommen werden und Veränderung mitgestalten [2].
Sollten Sie vor herausfordernde Konflikte gestellt sein, können Sie gerne die Unterstützung des Kompetenzzentrums Kommunale Konfliktberatung in Anspruch nehmen. Das Projekt „Kommunale Integrationsstrategien für Vielfalt und Teilhabe“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.“ Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vfb-saw.de/projekte/kompetenzzentrum-kommunale-konfliktberatung/
[2] „Wir für uns“ – Kommunale Konfliktberatung in der Altmark : https://www.vfb-saw.de/wp-content/uploads/2020/11/191223_broschu%CC%88re_web_einzel.pdf
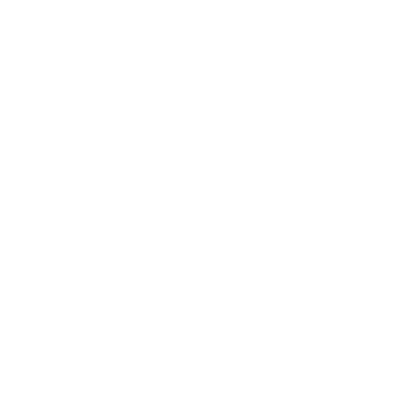 Gespräche und Erkenntnisse
Gespräche und Erkenntnisse

.jpg)

